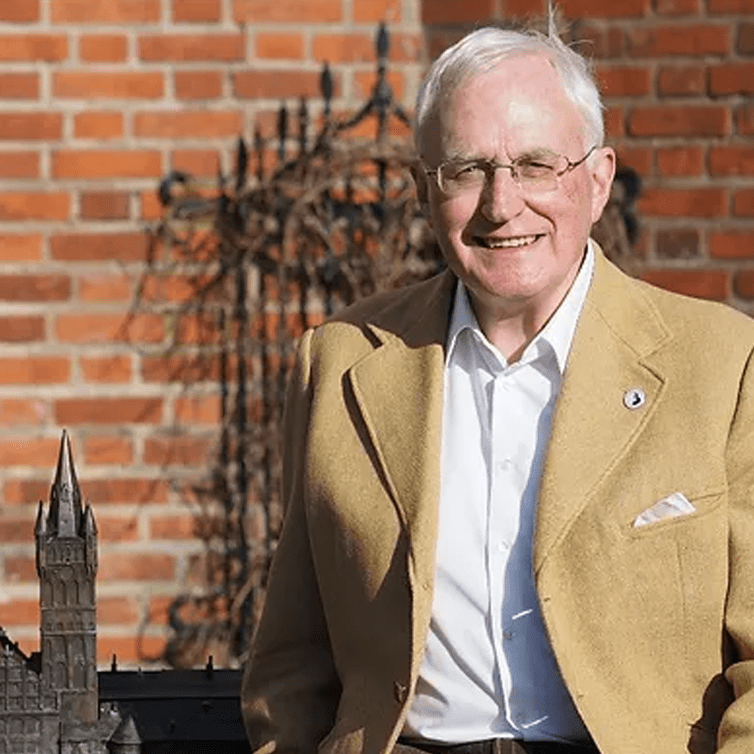Allgemeines: Kant ϋber die Berufung (Mission) der Frau
Die Frauen haben im Leben Immanuel Kants keine bestimmende oder auch bedeutende Rolle gespielt. Sie haben auch sein Schaffen kaum befruchtet, wie es bei anderen großen Mӓnnern seines Zeitalters: bei Goethe, Schiller, Herder und von Philosophen wie Fichte und Schelling der Fall war. Er ist sein ganzes Leben lang Jungeselle geblieben wie Plato und Leibniz, Deccartes und Hobbes, Locke und Hume. Aber andererseits war er kein Feind des weiblichen Geschlechts gewesen, wie Schopenhauer oder vollkommen gleichgϋltig dagegen wie Winckelmann. In seinen populӓren Schriften, besonders anthropologischen Vorlesungen und anderen Entwϋrfen beschӓftigte er sich recht hӓufig mit dem – wie er zu sagen pflegte – “Frauenzimmer”.
Aufschlußreich fϋr die Anschauungen Kants ϋber das weibliche Geschlecht ist der dritte Abschnitt der “Beobachtungen ϋber das Gefϋhl des Schӧnen und Erhabenen” (1764), wo er im Rahmen seines Themas den Gegensatz zwischen dem Erhabenen und Schӧnen auf die Charakteristik der Geschlechter anwendet. Das “Frauenzimmer” hat ein angeborenes und stӓrkeres Gefϋhl fϋr das Schӧne und Zierliche, liebt Scherz und Heiterkeit, Sittsamkeit und feinen Anstand, zieht das Schӧne dem Nϋtzlichen vor, hat einen schӧnen Verstand. Gleichzeitig macht er sich etwas lustig ϋber gelehrte Frauen, undem er meint, dass ihre Wissenschaft nicht Mathematik oder Mechanik oder abstrakte Spekulationen, sondern vielmehr “der Mensch, und unter den Menschen der Mann”; ihre Weltweisheit “nicht Vernϋnfteln, sondern Empfinden” sein soll.
“Das Frauenzimmer hat ein angeborenes stӓrkeres Gefϋhl fϋr alles, was schӧn, zierlich und geschmϋckt ist. Schon in der Kindheit sind sie gerne geputzt und gefallen sich, wenn sie geziert sind. Sie sind reinlich und sehr zӓrtlich in Ansehung alles dessen, was Ekel verursacht. Sie lieben den Scherz, und kӧnnen durch Kleinlichkeiten, wenn sie nur munter und lachend sind, unterhalten werden. Sie haben sehr frϋh ein sittsames Wesen, wissen sich einen feinen Anstand zu geben und besitzen sich selbst; …Sie sind von sehr zӓrtlicher Empfindung in Ansehung der mindesten Beleidigung, und ϋberaus fein, den geringsten Mangel der Aufmerksamkeit und Achtung gegen sie zu bemerken. Kurz, sie enthalten in der menschlichen Natur den Hauptgrund der Abstechung der schӧnen Eigenschaften mit den edelen und verfeinern selbst das mӓnnliche Geschlecht … Das schӧne Geschlecht hat eben so wohl Verstand als das mӓnnliche, nur es ist ein schӧner Verstand, der unsrige soll ein tiefer Verstand sein,… Zur Schӧnheit aller Handlungen gehӧret vornehmlich, daß sie Leichtigkeit an sich zeigen und ohne peinliche Bemϋhung scheinen vollzogen zu werden…Mϋhsames Lernen oder peinliches Grϋbeln, wenn es gleich ein Frauenzimmer darin hoch bringen sollte, vertilgen die Vorzϋge, die ihrem Geschlecht eigentϋmlich sind, und kӧnnen dieselbe wohl um der Seltenheit willen zum Gegenstande einer kalten Bewunderung machen, aber sie werden zugleich die Reize schwӓchen, wodurch sie ihre große Gewalt ϋber das andere Geschlecht ausϋben…Sie werden in der Geschichte sich nicht den Kopf mit Schlachten, und in der Erdbeschreibung nicht mit Festungen anfϋllen; denn es schickt sich fϋr sie eben so wenig, daß sie nach Schießpulver, als fϋr die Mannspersonen, daß sie nach Bisam [Wohlgeruch] riechen sollen” (850-853).
“Ebenso werden sie von dem Weltgebӓude nichts mehr zu kennen nӧtig haben, als nӧtig ist, den Anblick des Himmels an einem schӧnen Abende ihnen rϋhrend zu machen, wenn sie einigermaßen begriffen haben, daß noch mehr Welten und daselbst noch mehr schӧne Geschӧpfe anzutreffen seien”…(854).
“Die Tugend eines Frauenzimmers ist eine schӧne Tugend. Die des mӓnnlichen Geschlechts soll eine edele Tugend sein. Sie werden das Bӧse vermeiden, nicht weil es unrecht sondern weil es hӓßlich ist, und tugendhafte Handlungen bedeuten bei ihnen solche, die sittlich schӧn sind…Sie tun etwas nur darum,weil es ihnen so beliebt, und die Kunst besteht darin, zu machen, daß ihnen nur dasjenige beliebe, was gut ist. Ich glaube schwerlich, daß das schӧne Geschlecht der Grundsӓtze fӓhig sei, und ich hoffe dadurch nicht zu beleidigen, denn diese sind ӓußerst selten beim mӓnnlichen.Dafϋr aber hat die Vorsehung in ihren Busen gϋtige und wohlwollende Empfindungen, ein feines Gefϋhl fϋr Anstӓndigkeit und eine gefӓllige Seele gegeben” (855).
“Dem Schӧnen ist nichts so sehr entgegengesetzt als der Ekel, so wie nichts tiefer unter das Erhabene sinkt als das Lӓcherliche. Daher kann einem Manne kein Schimpf empfindlicher sein, daß er ein Narr, und einem Frauenzimmer, daß sie ekelhaft genannt werde…
Um von diesem Ekelhaften sich so weit als mӧglich zu entfernen, gehӧret die Reinlichkeit, die zwar einem jeden Menschen wohl ansteht, be idem schӧnen Geschlechte unter die Tugenden vom ersten Range, und kann schwerlich von demselben zu hoch getrieben werden, da sie gleichwohl bei einem Manne bisweilen zum Ubermaße steigt und alsdann lӓppisch wird” (857).
Nach Kant kӧnnen die Eigenschaften des Charakters der Frau – wie oben schon vorgefϋhrt – prӓgnanter dargestellt werden, wenn man sie mit denen des Mannes vergleicht. Ein solcher Vergleich zeigt sofort einen ausschlaggebenden Unterschied zwischen Mann und Frau, mit dem die Natur vor allem die Frau versorgt hatte, und das ist die Kunst. Kant erlӓutert das in der “Anthropologie” wie folgt:
“In alle Maschinen, durch die mit kleinerer Kraft so viel ausgerichtet werden soll, als durch andere mit großer, muß Kunst gelegt sein.Daher kann man schon im voraus annehmen: daß die Fϋrsorge der Natur in die Organisierung des weiblichen Teils mehr Kunst gelegt haben wird, als in die des mӓnnlichen, weil sie den Mann mit grӧßerer Kraft ausstattete als das Weib, [um beide zur innigsten leiblichen Vereinigung, doch auch als vernϋnftige Wesen zu dem ihr am meisten angelegenen Zwecke, nӓmlich der Erhaltung der Art zusammenzubringen, und ϋberdem sie in jener Qualitӓt (als vernϋnftige Tiere) mit gesellschaftlichen Neigungen versah, ihre Geschlechtsgemeinschaft in einer hӓuslichen Verbindung fortdauernd zu machen” (S.648)].
Diese Kunst der Frau besteht in der Fӓhigkeit, “sich der Neigung des Mannes zu ihr zu bemeistern”. Und das erzielt sie dank ihrer Schwӓchen. Und Kant erlӓutert weiter:
“Die Weiblichkeiten heißen Schwӓchen.Man spaßt darϋber; Toren treiben damit ihren Spott, Vernϋnftige aber sehen sehr gut, daß sie gerade die Hebezeuge sind, die Mӓnnlichkeit zu lenken und sie zu jener ihrer Absicht zu gebrauchen” (S.649).
Der zweite Faktor, von dem die Einheit und die Unauflӧslichkeit einer Verbindung zwischen Mann und Frau abhӓngt, ist – wie paradox das auch klingt – die Ungleichheit, d.h.” ein Teil muß dem anderen unterworfen und wechselseitig einer dem anderen irgendworin ϋberlegen sein, um ihn beherrschen oder regieren zu kӧnnen” (S.648). Und Kant setzt weiter fort:
“Ein Teil muß im Fortgange der Kultur auf hetorogene Art ϋberlegen sein: der Mann dem Weibe durch sein kӧrperliches Vermӧgen und seinen Mut, das Weib aber dem Manne durch ihre Naturgabe, sich der Neigung des Mannes zu ihr zu bemeistern; …” Das ist der Grund, warum die Gestalt der Frau fϋr die Anthropologie wichtiger als die des Mannes ist, oder um mit Kant zu sprechen:
“Daher ist in der Anthropologie die weibliche Eigentϋmlichkeit mehr als die des mӓnnlichen Geschlechts ein Studium fϋr den Philosophen”(648).
Auf welchen Prinzipien aber soll dieses Studium – nach Kant – beruhen?
In seiner “Anthropologie” findet sich folgendes darϋber:
“Man kann nur dadurch, daß man, nicht was wir uns zum Zwecke machen, sondern was Zweck der Natur bei Einrichtung der Weiblichkeit war, als Prinzip braucht, zur Charakteristik dieses Geschlechts gelangen, und da dieser Zweck, selbst vermittels der Torheit der Menschen, doch, der Naturabsicht nach, Weisheit sein muß: so werden diese ihre mutmaßlichen Zwecke auch das Prinzip derselben anzugeben dienen kӧnnen; welches nicht von unserer Wahl, sondern von einer hӧheren Absicht mit dem menschlichen Geschlecht abhӓngt. Sie sind 1. die Erhaltung der Art, 2. die Kultur der Gesellschaft und Verfeinerung derselben durch die Weiblichkeit” [S.651]. Was diese zweite Berufung der Frau angeht, soberichtet sein Biograph Jachmann:
“Kant wϋnschte, dass jeder Mensch nicht allein innerlich, sondern auch ӓußerlich, folglich seine Bildung vollenden mӧchte, weil auch letzteres zur Erreichung vernϋnftiger Zwecke im Leben unentbehrlich, folglich auch Pflicht wӓre“.
Kant selbst hatte solch eine Schule durch den Verkehr im Hause der Grӓfin Keyserlingk gemacht, und war dadurch zu einem galanten Magister geworden.
Aus diesem vernϋnftigen Grunde riet er auch seinen jungen Freunden an, den Umgang mit gebildeten Frauenzimmern, so oft sich dazu die Gelegenheit darbӧte, aufs sorgfӓltigste zu benutzen, weil dieses das einzige Mittel wӓre, ihre Sitten zu verfeinern und zu veredeln. Ja, er hielt die Benutzung dieses Bildungsmittels fϋr eben so notwendig, als die Sorge zur Ausbildung des Geistes…und war daher der Meinung, dass ein junger Mann, der sich fϋr die Welt ausbilden will, Gesellschaften gebildeter Damen so oft wie mӧglich besuchen mϋsse.(S. 128)
In der “Anthropologie” ӓußert er sich ϋber das weibliche Geschlecht wie folgt:
“Weibliche Tugend oder Untugend ist von der mӓnnlichen, nicht sowohl der Art als der Triebfeder nach, sehr unterschieden.- Sie soll geduldig, er muß duldend sein. Sie ist empfindlich, er empfindsam.- Des Mannes Wirtschaft ist Erwerben, die des Weibes Sparen. – Der Mann ist eifersϋchtig, wenn er liebt; die Frau auch ohne daß sie liebt; weil so viel Liebhaber, als von anderen Frauen gewonnen worden, doch ihrem Kreise der Anbeter verloren sind. – Der Mann hat Geschmack fϋr sich, die Frau macht sich zum Gegenstande fϋr jedermann. – “Was die Welt sagt, ist wahr, und was sie tut, ist gut”, ist ein weiblicher Grundsatz, der sich schwer mit einem Charakter, in der engen Bedeutung des Wortes vereinigen lӓßt” (S.654).
“Die Frau will herrschen, der Mann beherrscht sein (vornehmlich vor der Ehe)….das Weib ist weigernd, der Mann bewerbend; ihre Unterwerfung ist Gunst.- Die Natur will, daß das Weib gesucht werde; daher muß sie selbst nicht so delikat in der Wahl (nach Geschmack) sein, als der Mann, den die Natur auch grӧber gebaut hat… Der Mann bewirbt sich in der Ehe nur um seines Weibes, die Frau aber um aller Mӓnner Neigung; sie putzt sich nur fϋr die Augen ihres Geschlechts aus Eifersucht andere Weiber in Reizen oder im Vornehmtun zu ϋbertreffen…Der Mann beurteilt weibliche Fehler gelind, die Frau aber (ӧffentlich) sehr strenge, und junge Frauen, wenn sie die Wahl hӓtten, ob ihr Vergehen von einem mӓnnlichen oder weiblichen Gerichtshofe abgeurteilt werden solle, wϋrden den ersten zu ihrem Richter wӓhlen…- In der Ehe spotten Weiber ϋber Intoleranz (Eifersucht) der Mӓnner ϋberhaupt; es ist aber nur ihr Scherz; das unverehlichte Frauenzimmer richtet hierϋber mit großer Strenge…” (S.654).
Wie es aus diesen Passagen folgt, legt Kant viel Sympathie fϋr die Frauen an den Tag. Nur fϋr die gelehrten Frauen scheint er nicht viel ϋbrig zu haben, wenn er folgendes sagt:
“Was die gelehrten Frauen betrifft: so brauchen sie ihre Bϋcher etwa so wie ihre Uhr, nӓmlich sie zu tragen, damit gesehen werde, daß sie eine haben; ob sie zwar gemeiniglich still steht oder nicht nach der Sonne gestellt ist” (S.654).
Der Bϋrgermeister der Stadt Kӧnigsberg und einer der aktivsten Tischfreunde Kants Hippel trat, wie bekannt, fϋr die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau auf, wobei er die Sache der Frauen verfochten hatte. Kant scheint seinem eherwϋrdigen Freund nicht ganz beizupflichten, wenn er einer ganz anderen Meinung war, nӓmlich:
“Das Weib wird durch die Ehe frei; der Mann verliert dadurch seine Freiheit”; er wird also von der Frau beherrscht…” Und Kant stellt diesbezϋglich direkt die Frage: Wer soll denn den oberen Befehl im Hause haben? Und seine Antwort erfolgt in der fϋr ihn typischen kompromisshaften Manier:
“Ich wϋrde in der Sprache der Galanterie (doch nicht ohne Wahrheit sagen): die Frau soll herrschen und der Mann regieren; denn die Neigung herrscht und der Verstand regiert” (657).
* * *
Doch nun vom Allgemeinen zum mehr Persӧnlichen.
Also. Welche Erlebnisse haben Kant dazu bewogen, sich mit dem “Frauenzimmer” zu beschӓftigen?
In erster Linie war es das schӧne Verhӓltnis zwischen ihm und seiner Mutter, die er nie vergaß.
Kants Schϋler, Freund und spӓter Biograph Reinhold Bernhard Jachmann schreibt darϋber, was Kant ihm von seiner Mutter erzӓhlte, nӓmlich:
“Meine Mutter”, so ӓußerte sich oft Kant gegen mich, „war eine liebreiche, gefϋhlvolle, fromme und rechtschaffene Frau und eine zӓrtliche Mutter, welche ihre Kinder durch fromme Lehren und tugendhaftes Beispiel zur Gottesfurcht leitete. Sie fϋhrte mich oft außerhalb der Stadt, machte mich auf die Werke Gottes aufmerksam, ließ sich mit einem frommen Entzϋcken ϋber seine Allmacht, Weisheit und Gϋte aus und drϋckte in mein Herz eine tiefe Ehrfurcht gegen den Schӧpfer aller Dinge.Ich werde meine Mutter nie vergessen, denn sie pflanzte und nӓhrte den ersten Keim des Guten in mir, sie ӧffnete mein Herz den Eindrϋcken der Natur; sie weckte und erweiterte meine Begriffe, und ihre Lehren haben einen immerwӓhrenden, heilsamen Einfluß auf mein Leben gehabt.
Wenn der große Mann von seiner Mutter sprach, dann war sein Herz gerϋhrt, dann glӓnzte sein Auge und jedes seiner Worte war der Ausdruck einer herzlichen und kindlichen Verehrung” (S.143).
Und an einer anderen Stelle:
“Es ist um so merkwϋrdiger, daß der große innere Wert dieser vortrefflichen Frau auf das Herz unseres Weltweisen einen so bleibenden und unvertilgbaren Eindruck gemacht hat, da er doch nur bis zum dreizehnten Jahre ihren lehrreichen Umgang genoß “ (S.143).
Zu seinen Schwestern gab es keine nӓheren Beziehungen.Er ließ sich selten ϋber sie aus. Sie mußten sich als Dienstmӓdchen verdingen und haben spӓter Handwerker geheiratet.
Doch. Noch in den ersten Jahren seines Professorats haben seine Schwestern grӧßere Ansprϋche auf seine Unterstϋtzung gemacht, als sie durch ihn erfϋllt bekamen und haben darϋber sogar Beschwerden geӓußert. Aber damals besaß Kant verhӓltnismӓßig fϋr seinen Stand nicht mehr und vielleicht weniger als sie selbst…Er gab, soviel er entbehren konnte und soviel er nach den Umstӓnden rӓtlich fand und erklӓrte seiner Familie, dass er bei Krankheit und Not ihr seine Hilfe nie absagen wϋrde, welches er auch treulich erfϋllte.
Jachmann verweist noch darauf, dass Kant seinen Schwestertӧchtern bei ihrer Heirat hundert Reichstaler zur ersten Einrichtung gab, weil er ihnen dadurch zum eigenen leichteren Broterwerb verhelfen wollte.
Ludwig Ernst Borowski, kein unbekannter Biograph Kants, geht auch auf dieses Thema in seinem biographischen Aufsatz “Leben und Charakter Immanuel Kants” ein. Dazu schreibt er folgendes:
“Waren unseres Kant Schwestern gerade auch nicht im nӓhern Umgange mit ihm,…so waren sie doch, sobald seine Lage es mӧglich machte,Gegenstӓnde seiner stillen, ganz gerӓuschlosen Wohltӓtigkeit. Der einen von ihnen erkaufte er eine lebenswierige Stelle in einer hiesigen milden Stiftung und unterstϋtzte sie, sowie die Kinder einer anderen, frϋher verstorbenen Schwester, hinlӓnglich, auch wohl reichlich. Seiner verwitweten Schwӓgerin ließ er fϋr sich und ihre Kinder jӓhrlich 200 Taler durch seinen hiesigen Freund, den Kaufmann Konrad Jakobi, auszahlen. Diese seine Blutsverwandten sind außer einigen Legatarien, die Erben seines ganzen Nachlasses…” (S.57)
Wie oben erwӓhnt, war Kant kein abgesagter Feind des Ehestandes, sondern er riet selbst seinen Freunden, die er durch eine gute Partie zu beglϋcken wϋnschte und deren Stand die Ehe rӓtlich machte, freilich nach seinen Grundsӓtzen die Heirat an und sorgte sogar selbst fϋr eine gute Wahl. Es ist interessant, dass Kant fϋr den Bruder Jachmanns schon mehrere Monate vor dessen Zurϋckkehr aus England, Demoiselle B…, damals eines der reichsten Mӓdchen in Kӧnigsberg, ausgesucht hatte. Und schon am ersten Tag seines Besuchs legte Kant ihm diese Wahl mit solcher Teilnahme ans Herz, dass der Bruder Jachmanns Kant das Gestӓndnis ablegen mußte, er habe bereits ein Mӓdchen nach seinem Herzen gewӓhlt, was Kant wirklich betrϋbte.
Obgleich Kant im Zӧlibat lebte, hatte er doch selbst in seinem hӧchsten Alter noch Sinn und Gefϋhl fϋr weibliche Schӧnheit und Reize. An Miss A…, welche sich im Hause seines Freundes Motherby aufhielt, und fϋr dessen Sohn zur Braut bestimmt war, fand Kant noch nach seinem siebzigsten Jahre ein so besonderes Wohlgefallen, dass er sie bei Tische stets auf der Seite seines gesunden Auges neben ihm Platz zu nehmen bat. Das zeugt davon, dass er in seinem ganzen Leben als Mensch das Schӧnheitsgefϋhl kultiviert hatte, welches selbst im hohen Alter in seiner Seele nicht erstarb.
“Warum aber sahen wir Kant nie in ehelicher Verbindung?” fragt Ludwig Ernst Borowski in seinem Aufsatz “Leben und Charakter Immanuel Kants”. Und er antwortet sich selbst wie folgt:
Dies ist “ eine Frage, die oft genug bei seinen Lebzeiten von Hӧhern und Niedrigen, von Freunden und auch solchen, die sonst gegen ihn gleichgϋltig waren, aufgeworfen ward. Wenn diese Frage an ihn selbst, besonders in seinen spӓteren Jahren gebracht ward, empfand erˈs nicht gut; wich dem Gesprӓch darϋber, das er mit Fug und Recht als Zudringlichkeit ansah, aus; – ӓußerte auch wohl nachdrucksvoll, ihn mit Heiratsantrӓgen zu verschonen.
Diesbezϋglich erzӓhlt Jachmann eine fϋr das Verhalten Kants zur Ehe aufschlussreiche Episode:
„Sollte aber Kant, der doch selber bisweilen fϋr seine Freunde Heiratsplӓne (aber freilich fast immer nur, um ihre ӧkonomische Lage zu bessern oder zu sichern) entwarf, sollte er selbst denn nie geliebt haben? Stand ihm hier vielleicht eine Maxime im Wege? – Nein, nein, denn Kant – hat geliebt. Mir sind zwei seiner ganz wϋrdige Frauenzimmer (wem kann an den Namen etwas gelegen sein!) bekannt, die nacheinander sein Herz und seine Neigung an sich zogen. Aber freilich war er da nicht mehr im Jünglingsalter, wo man sich schnell bestimmt und rasch wӓhlt. Er verfuhr zu bedenklich, zӧgerte mit dem Antrage, der wohl nicht abgewiesen worden wӓre, und – darϋber zog eine von diesen in eine entferntere Gegend und die andere gab einem rechtschaffenen Manne sich hin, der schneller als Kant im Entschließen und Zusagefordern war.
Sein Leben war (keiner seiner Vertrautesten von Jugend auf, wird mir hier widersprechen) im strengsten Verstande zϋchtig. Aber deswegen war er nicht etwa ein Feind des anderen Geschlechts. Er befand sich im Umgange mit den gebildeten Frauen; verlangte von ihnen nicht Gelehrsamkeit, aber was man guten gesunden Verstand nennt; dann Natϋrlichkeit, Heiterkeit, Hӓuslichkeit und die tӓtige Aufsicht aufs Haus- und Kϋchenwesen…Von einem weiblichen Wesen, das ihn an seine “Kritik der reinen Vernunft” erinnert, oder ϋber die franzӧsische Revolution mit ihm ein Gesprӓch hӓtte anknϋpfen wollen, wϋrde er sofort sich abgewendet haben. Einmal ließ er gegen eine vornehme Dame, die durchaus mit ihm ganz gelehrt sprechen wollte, und da sie bemerkte, daß er immer auswich, fortwӓhrend behauptete, daß Damen auch wohl eben so gelehrt sein kӧnnten, als Mӓnner, und daß es wirklich gelehrte Frauen gegeben hӓtte, sich den freilich etwas derben Ausdruck entfallen: “Nun ja, es ist auch darnach”.
“Ein andermal in meinem Beisein, da eben ein Gesprӓch ϋber Zubereitung der Speisen etwas ausfϋhrlich ward, sagte ihm eine wϋrdige auch von ihm sehr geschӓtzte Dame: “Es ist doch, lieber Herr Professor, wirklich, als ob sie uns alle bloß fϋr Kӧchinnen ansehen”. Und da war es eine Freude zu hӧren, mit welcher Gewandheit und Feinheit er es auseinandersetzte, daß Kenntnis des Kϋchenwesens und die Direktion davon jeder Frauen Ehre sei; …Wirklich, er zog die Herzen aller Damen durch diese Auseinandersetzungen, die er lebhaft und launigst vortrug, ganz an sich.Jede wollte von ihrem Manne das Zeugnis an den Professor haben, daß sie eine solche Frau sei; …”(61)
Und Borowski fϋhrt die Worte von Frau von der Recke an, die Kant persӧnlich kannte und seine Konversation in weiblicher Gesellschaft genoss: “… Ich kenne ihn durch seine Schriften nicht, weil seine metaphysische Spekulation ϋber den Horizont meines Fassungsvermӧgens ging.- Aber schӧne geistvolle Unterhaltungen dank ich dem interessanten persӧnlichen Umgange dieses berϋhmten Mannes, tӓglich sprach ich diesen liebenswϋrdigen Gesellschafter in dem Hause meines Vetters, des Reichsgrafen von Keyserlingk zu Kӧnigsberg. Kant war der dreißigjӓhrige Freund dieses Hauses und liebte den Umgang der verstorbenen Reichsgrӓfin, die eine sehr geistreiche Frau war…Im gesellschaftlichen Gesprӓch wußte er bisweilen sogar abstrakte Ideen in ein liebliches Gewandt zu kleiden und klar setzte er jede Meinung auseinander, die er behauptete. Anmutsvoller Witz stand ihm zu Gebote, und bisweilen war sein Gesprӓch mit leichter Satire gewϋrzt, die er immer mit der trockensten Miene anspruchslos hervorbrachte”. (62)
Auch Reinhold Jachmann in seinem Werk “Immanuel Kant geschildert in Briefen” geht auf das Thema Kant und die Liebe ein, nӓmlich:
“Daß Kant in seiner Jugend geliebt habe, das mӧchte ich nach seinem Temperamente und nach seinem gefϋhlvollen Herzen beinahe mit vӧlliger Gewißheit zu behaupten wagen. Wie sollte auch ein Mann, der so ein warmes Herz fϋr Freundschaft hatte, nicht auch ein warmes Gefϋhl fϋr Liebe gehegt haben? Ob aber seine erste Liebe sich keiner Gegenliebe zu erfreuen hatte, oder ob seine kӧrperliche Beschaffenheit und sein entschiedener Hang nach metaphysischen Spekulationen und wissenschaftlichen Beschӓftigungen ihm anrieten, der Ehe zu entsagen, dies muß ich unentschieden lassen. In seinem Alter schien mir Kant eben nicht große Begriffe von der Liebe zu hegen, wenigstens ӓußerte er oft gegen seine unverheiratete Freunde den Rat: sie mӧchten bei der Wahl ihrer kϋnftigen Gattin ja lieber vernϋnftigen Grϋnden als einer leidenschaftlichen Neigung folgen.
Diesen Rat unterstϋtzte er noch durch das Urteil anderer, in der Sache erfahrener Mӓnner, dem er seinerseits gӓnzlich beipflichtete. Er pflegte ӧfters anzufϋhren, ein verstӓndiger Mann, Herr C., habe zweimal geheiratet. Die erste Frau, welche nichts weniger als wohlgestaltet gewesen, habe er vorzϋglich ihres Vermӧgens wegen gewӓhlt; die andere, ein schӧnes Frauenzimmer, habe er aus herzlicher Liebe genommen; am Ende aber doch gefunden, daß er mit beiden gleich glϋcklich gewesen wӓre. Kant war daher der Meinung, daß wenn man bei der Wahl einer Gattin außer den guten Qualitӓten der Hausfrau und Mutter noch auf ein sinnliches Motiv sehen wolle, man lieber auf Geld Rϋcksicht nehmen mӧchte, weil dieses lӓnger als alle Schӧnheit und aller Reiz vorhalte, zum soliden Lebensglϋck sehr viel beitrage und selbst das Band der Ehe fester knϋpfe, weil der Wohlstand, in welchen sich der Mann dadurch versetzt sieht, ihn wenigstens mit liebenswϋrdiger Dankbarkeit gegen seine Gattin erfϋlle. Ubrigens dachte er ϋber den Ehestand ganz wie der Apostel Paulus 1. (Korinther 7,7,8) und bestӓtigte dies noch durch das Urteil einer sehr verstӓndigen Ehefrau, welche ihm ӧfters gesagt hӓtte: ist dir wohl, so bleibe davon!” (141)
Doch unser Philosoph folgte diesem seinem Rat in der Magisterzeit nicht besonders eifrig. Wie Karl Vorlӓnder in seinem Buch “Immanuel Kant. Der Mann und das Werk” berichtet, “hat sich Kant von den Reizen eines Kӧnigsberger Mӓdchens von etwas leichterer Art eine Zeitlang bestechen lassen. Wer es war, ist freilich unsicher”. Nach Vorlӓnder, sollte es sich um “eine gewisse Luise Rebekka Fritz (1744) handeln, die als Frau Obereinnehmer Ballath hochbetagt in der ostpreußischen Hauptstadt starb, in ihren spӓteren Jahren “oft und viel und immer mit stolzem Ruhme” davon zu erzӓhlen pflegte, daß Kant sie einst geliebt habe”.
“ Nun ist aber aktenmӓßig festgestellt”, so Vorlӓnder,” daß in der Tat eine 1744 geborene Luise Rebekka Fritz am 18.Oktober 1768 einen Herrn Ballath heiratete, der spӓter zusammen mit Hamann am Lizentamt angestellt war.Und von diesem Frӓulein Fritz schreibt Hippel im November 1768 ziemlich ironisch von der”weiland Ehr- und Tugendbelobten Jungfer Fritz, deren Ehrˈund Tugend schon im russischen Kriege gelitten haben soll” und die nun einen Herrn B. geheiratet habe…”(131) …dieser etwas etwas zweifelhafte Ruf der Dame…stimmt ganz wohl zu dem, was Kants Schϋler und spӓterer Kollege Kraus von einer “Kӧnigsbergerin” berichtet, die Kant “zu heiraten gewϋnscht” habe.
Der Philisoph selbst habe “darϋber einmal” das Wort “fallen lassen”, daß “bei nӓhrer Ansicht das Gleißende sehr geschwunden sei, d.h. daß er eine seiner wϋrdige weibliche Seele da nicht gefunden habe”.
Man kann vermuten, dass Kants spӓtere Ausfϋhrungen in der “Anthropologie” ϋber weibliche Koketterie auf seine eigene Erfahrung mit diesem “Frauenzimmer” zurϋckzufϋhren sind.
* * *
Aber weit mehr aufgeregt machte die vornehmen Kreise Kӧnigsbergs eine andere unserem Philisophen sehr gut bekannte Dame Maria Charlotta Jacobi, die Frau von Kants Freund, dem Geheimen Kommerzienrat Conrad Jacobi. M.CH. Jacobi stammte aus der reichen und angesehenen Patrizierfamilie Schwinck und war am 7.Juli 1739 geboren.Im Juni 1752 also noch nicht ganz 13 Jahre alt, heiratete sie den damaligen “Bankier und Negotianten” Johann Conrad Jacobi, der 22 Jahre ӓlter war als sie. Der viel beschӓftigte Gemahl ließ der jungen Frau, in die er verliebt war, viel Freiheit. Sie war die Kӧnigin der Bӓlle und Festlichkeiten in Kӧnigsberg. Sie war also nicht eine beliebige Kӧnigsbergerin, sondern die gefeiertste Schӧnheit der Stadt, die an einem schӧnen Sommertag des Jahres 1762 aus ihrem Garten an Magister Kant ein Briefchen schrieb, welches folgenden Inhalt hatte:
“Werter Freund
Wundern Sie sich nicht, daß ich mir unterfange, an Sie, einen großen Philosophen, zu schreiben? Ich glaube Sie gestern in meinem Garten zu finden, da aber meine Freundin mit mir alle Alleen durchgeschlichen, und wir unseren Freund unter diesem Zirkel des Himmels nicht fanden, so beschӓftigte ich mich mit Verfertigung eines Degenbandes, dieses ist Ihnen gewidmet. Ich mache Ansprϋche auf Ihre Gesellschaft morgen nachmittag. Ja, ja, ich werde kommen, hӧre ich Sie sagen. Nun gut, wir erwarten Sie, dann wird auch meine Uhr aufgezogen werden. Verzeihen Sie mir diese Erinnerung. Meine Freundin und ich ϋberschicken Ihnen einen Kuß, per Sympathie, die Luft wird doch wohl im Kneiphof dieselbe sein, damit unser Kuß die sympathische Kraft nicht verliert. Leben Sie vergnϋgt und wohl! Jacobin.
Aus dem Garten, den 12.Juni 1762.”
Der ganze Ton des Briefes ist neckisch und natϋrlich und sieht gar nicht nach der etwas stolzen und kalten Weltdame aus, als die sie auf einem uns erhaltenen Bilde erscheint. Freilich zӓhlte sie damals erst 23 Jahre. In dem Brief von Jacobi findet sich die Anspielung auf die Aussage Kants, welche er in seinen Vorlesungen ϋber die gelehrten Damen einmal ӓußerte, nӓmlich:”sie brauchen ihre Bϋcher ebenso wie ihre Uhr, nӓmlich sie zu tragen, damit gesehen werde, daß sie eine haben; ob sie zwar gemeiniglich stillsteht oder nicht nach der Sonne gestellt ist” (Vorlӓnder,133).
Dreieinhalb Jahre spӓter stoßen wir wieder auf Frau Jacobi in Kants
Briefwechsel. Im Januar 1766 befand sie sich in Berlin in Begleitung ihres Mannes zu einer Augenkur. Aber da bekam ihr Mann schlechte geschӓftliche Nachrichten und musste nach Hause fahren, wӓhrend seine Frau allein zurϋckblieb.Kurz vorher hat Kant an sie einen liebenswϋrdigen Brief geschrieben, in dem es hieß:” einige reihen in ihrem letzten Briffe sind zu schmeichelhaft fϋr mich, als daß ich sie beantworten kӧnnte” (S.134).
Kant meint vielleicht die Bitte von Jacobi an Kant, sie von Berlin nach Kӧnigsberg zurϋckzubegleiten, was Kant vielleicht versprochen hatte, denn sie schreibt in ihrem Brief an Kant folgendes:” ϋbrigens, mein werter Freund, haben Sie eine Ungerechtigkeit begangen und sind dafϋr Abbitte schuldig, daß Sie mir die Hoffnung benehmen, in ihrer Gesellschaft nach Kӧnigsberg zu reisen” (S.134).
Die Handelsgeschӓfte des Herrn Jacobi schienen damals schlecht gegangen zu sein, denn sie schreibt in diesem Zusammenhang von einem “Abgrund von Widerwӓrtigkeiten” und bedauert Kant gegenϋber, daß sie nicht das Vermӧgen habe, „seine Verdienste…zu belohnen und ihn dadurch von allen mϋhsamen Verbindungen zu befreien” (134).
Spӓter erfahren wir, dass das Ehepaar Jacobi sich scheiden ließ. Denn ihr Schicksal sollte ein gewisser Herr “Mϋnzmeister” werden. Es war der Pfarrersohn Johann Julius Gӧschen aus Braunschweig, ein Verwandter des berϋhmten Leipziger Buchhӓndlers. Gӧschen, 1740 geboren, hatte seit kurzer Zeit eine Anstellung an der Kӧnigsberger Mϋnze gefunden. Er verkehrte nun so nah mit den Jacobis, daß er im Winter 1767/68 sogar mit ihnen gemeinsam eine Loge im Theater besaß, in die ӧfters auch Hippel und zuweilen vielleicht Kant gegangen sind. Maria Charlotte ϋbertrug ihre Liebe auf den ihr gleichaltrigen Hausfreund, der ja auch kein Weiberverӓchter gewesen zu sein scheint.
Der weitere Verlauf der Sache geht aus Hippels Briefen an Scheffner hervor: “Kϋnftigen Montag wird Jacobi mit seiner Frau geschieden. Die Ursache der Scheidung ist ein Ehebruch, den sie allein nicht nur zugesteht, sondern auch, ohne Zweifel in der Hoffnung, daß sie Gӧschen heiraten wird, aus der Ursache begangen zu haben vorgibt, weil sie geschieden werden und von einem so nichtswϋrdigen Kerl, wie sie sagt, loskommen wollte…Die Prinzessin Jacobi ist gefallen. Alle Welt verachtet sie, und die, so durch sie umdunkelt worden, triumphieren…” (136).
Frau Maria Charlotta verkaufte ihr schӧnes Haus in der Junkerstraße und bezog ein einfacheres in der Landhofmeisterstraße. Am 23. Oktober fand …die Trauung im Hause (nicht in der Kirche) statt. Kant hatte sich entschieden auf die Seite des verlassenen Ehemanns gestellt und blieb der Hochzeit fern. Hippel schreibt an Scheffner: “Herr Magister Kant, der ein recht guter Junge und mein recht sehr guter Freund ist und bleibt, hat soviel Wunderliches von der jetzigen Frau Mϋnzmeisterin, weiland Frau Geheimde Rӓtin, zu ihrem Gemahl gesagt und sich wider diese Heirat so empӧrt, daß er Bedenklichkeiten findet, sich bei ihr zu zeigen” (136).
Lange hat, im Unterschied zu Hippel u.a., Kant sich von dem einstigen guten Freunde Gӧschen infolge dieser Eheaffӓre ferngehalten. Jachmann berichtet darϋber wie folgt:
“(M)ϋnz (D)irektor (G)ӧschen…machte (sc. nach seiner Heirat) ein angenehmes Haus in Kӧnigsberg, das von sehr vielen Fremden besucht wurde. Kant wurde sehr hӓufig und sehr dringend hier eingeladen, aber er betrat nie die Schwelle dieses Hauses, aus Achtung fϋr den ersten Mann, mit welchem er fortwӓhrend in einem freundschaftlichen Umgange lebte. Er hielt es fϋr unerlaubt und fϋr unschicklich, mit beiden Mӓnnern zugleich in einem freundschaftlichen Verhӓltnisse zu leben, glaubte den ersteren dadurch zu beleidigen und dem anderen Glauben beizubringen, als wenn er sein tadelhaftes Benehmen gut hieße. Mir ist es bekannt, daß ihn jetzt, so wie er handelte, beide Mӓnner schӓtzten und verehrten” (S.137).
Ob nach Jacobis Tod (1774) dieser Grund wegfiel? Jedenfalls erzӓhlt Hamann am 21. November 1786 von einer Mittagsgesellschaft, an der Kant und Gӧschen teilnahmen. Von 1790 ab war die Wiederherstellung der alten Freundschaft bezeugt. Am 8. Juni 1795 bestellt Kiesewetter von Kant brieflich viele herzliche Empfehlungen an den Mϋnzdirektor, dem er bessere Gesundheit wϋnscht, und Familie.
Auch das Haus der Familie Gӧschen stand seitdem als eins der gastlichsten Hӓuser in Kӧnigsberg im besten Ruf und Ansehen. Frau Maria Charlotta starb am 4. Januar 1795, ϋberlebt von ihrem Manne um drei Jahre und von dem Freunde ihrer jungen Jahre, dem Magister Kant.