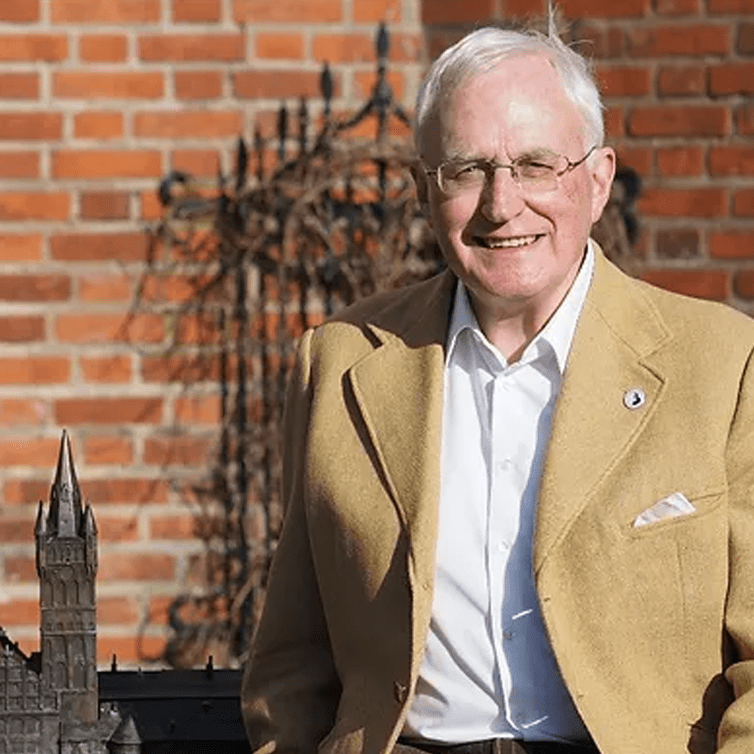1. Eine humane Schuldigkeit. Sklaverei und Völkermord sind singuläre Verbrechen der Menschen. Bei Tieren kommen sie nicht vor, was ein Motiv mehr sein sollte, das menschheitliche Versagen wissenschaftlich aufzuarbeiten. Dabei hat, über das Verlangen nach Erkenntnis hinaus, ein vorrangiger Grund das Bewusstsein der Schuld zu sein, die auf uns allen lastet. Damit hat die Wissenschaft eine gleichermaßen epistemische wie moralische Pflicht, sich Rechenschaft über die in Frage stehende Humanität zu geben; sie hat auch spezielle historische Einflussgrößen und Verantwortlichkeiten zu ermitteln, die uns über die näheren Ursachen aufzuklären vermögen. Es wäre immerhin ein kleines Stück Versöhnung mit uns selbst, wenn wir sicher sein könnten, dass ernsthaft an der Aufhellung und Aufklärung unserer beschämenden Vorgeschichte gearbeitet wird.
Dass die wissenschaftliche Aufarbeitung mit größter Sorgfalt zu geschehen hat, sollte sich von selbst verstehen. Wenn aber einer glaubt, einer sensationellen Entdeckung auf der Spur zu sein, hat er mit besonderer Gründlichkeit und genauer Kenntnis des historischen Umfeldes zu arbeiten. Denn es wäre tatsächlich eine Sensation, wenn ausgerechnet der Philosoph, der uns den größten Aufschluss über die moralische und rechtliche Unverzichtbarkeit der Idee der Menschheit gegeben hat, als Propagandist ihrer Verkehrung entlarvt werden müsste. Es ist daher verständlich, dass die These, Kant sei ein Rassist, so große Aufmerksamkeit auf sich zieht.
2. Kleine Völkerkunde des Geschmacks. Die Kant zur Last gelegten Aussagen gibt es in zwei eng begrenzten Themenfeldern seines Werkes. Das erste braucht keineswegs als philosophisch randständig angesehen zu werden, weil es dem Anschein nach im Bereich einer eher populären Unterhaltung liegt. Denn es gehört zur Vorgeschichte der wenig später aufblühenden Völkerpsychologie sowie zu Kants Anthropologie und Ästhetik.
Der in seiner Heimatstadt hoch angesehene „elegante Magister“ Kant hat 1764 beim Königsberger Publikum, das er gelegentlich in Zeitungsaufsätzen wie auch in allgemeinverständlichen Vorlesungen über naturkundliche Vorgänge unterrichtete, mit einem kleinen Buch unter dem Titel Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen besondere Anerkennung gefunden. Darin verbreitet er sich auch über den Charakter von Völkern und Menschen – soweit sie sich, wie der Autor betont, auf das „Gefühl des Erhabenen und des Schönen“ beziehen.
Kant geht es wesentlich um die Charaktere der europäischen Nachbarn, der Italiener, Spanier, Franzosen, Engländer und Holländer im Vergleich mit den Deutschen. So sagt er über die Engländer, sie seien „kaltsinnig und gegen einen Fremden gleichgültig“, während er die Franzosen zwar für „artig, höflich und gefällig“ hält, aber durch ihre Schwäche für das „schöne Geschlecht“ neigten sie zum „Leichtsinn“, der an das „Läppische“ grenze. Die Gemütsart der Deutschen liege zwischen der der Engländer und der Franzosen, komme aber dem Engländer näher; und wo der Deutsche dem Franzosen nahe stehe, sei das „nur gekünstelt und nachgeahmt“ (2, 248). Das künstlerische Talent der Italiener und Spanier wird gelobt, ihr impulsiver Charakter aber weniger geschätzt. Besonders positiv fällt das Urteil über die „ordentliche und emsige Gemüthsart“ der Holländer aus.
Kant ist sich der Problematik seiner Urteile durchaus bewusst. Deshalb schickt er seiner unterhaltsamen Schilderung die Bemerkung voraus, dass seinen Beobachtungen nur eine „leidliche Richtigkeit“ zukommen könne und dass es in allen Völkern rühmliche Ausnahmen gebe. Außerdem fügt er eine Einladung zum Widerspruch hinzu: Jeder Nachbar, der sich beleidigt fühle, solle nur seine Argumente „wie einen Ball“ zurückschlagen.
Den anschaulich erläuterten Bemerkungen über die europäischen Nachbarn, fügt Kant eine kurze Bewertung der in anderen Erdteilen lebenden Völker hinzu. Überschwänglich positiv sind die Urteile über die Araber und die Perser, vornehmlich wegen ihrer großen Leistungen in der Dichtung. Die Japaner hält er für die Engländer des Ostens. Vorwiegend kritisch sieht er dagegen die Inder und die Chinesen, weil er die Praxis ihrer Religionsausübung für lebens-und menschenfeindlich hält. Sein Beispiel ist die Lebensweise der Fakire. Und die „läppischen Fratzen“ in der Darstellung ihrer Götter hält er für abschreckend. Am vorteilhaftesten fällt Kants Urteil über die nordamerikanischen „Wilden“ aus. Ihnen attestiert er einen „erhaben Gemüthscharakter“; die kanadischen Indianer hält er zudem für „wahrhaft und redlich“.
Und dann gibt es den einen, immer wieder als Beweisstück für Kants „Rassismus“ angeführten Satz: „Die Negers von Afrika haben von der Natur kein Gefühl, welches über das Läppische stiege.“ (2, 253) Er sagt nicht, sie haben von Natur aus kein Gefühl, sondern er meint, sie hätten nicht das Gefühl für dieNatur, von dem er meint, dass es ästhetischen Ansprüchen genüge.
Hier gibt Kant schon im nächsten Satz seine Quelle an, nämlich den schottischen Philosophen David Hume, der behauptet hatte, man finde auch unter „hunderttausenden von Schwarzen“, die aus ihren Ländern „verführt“ (!) worden seien, keinen einzigen, der „in Kunst und Wissenschaft“ etwas Rühmliches geschaffen habe. Diesem Urteil schließt Kant sich mit der Bemerkung an, der Unterschied in den „Gemüthsfähigkeiten“ sei offenbar so groß wie in den Farben der Haut.
Schließlich erfährt man noch, warum Kant es auch bei den Schwarzen für angebracht hält, vom „Läppischen“ zu sprechen: Er hält es für „Götzendienst“, eine „Feder“, ein „Kuhhorn“ oder eine „Muschel“ zum „Gegenstand der Verehrung“ zu machen. Er schließt mit der summarischen Bemerkung: „Die Schwarzen sind sehr eitel, aber auf Negerart und so plauderhaft, daß sie mit Prügeln müssen auseinandergejagt werden.“ (2, 253)
Kants Urteil ist nicht nur ästhetisch grob und ahnungslos; es verrät auch seine Herkunft aus einer Zeit, in der man an der Prügelstrafe nichts Sträfliches fand. Nach unseren Maßstäben ist es im höchsten Maße politisch inkorrekt. Aber ist es deshalb schon „rassistisch“? Wenn das ein junger Leser heute so empfinden sollte, wird man ihm das als Zeichen einer guten, zeitgemäßen Erziehung hoch anrechnen. Wenn aber ein Historiker, der sich des geschichtlichen Abstands von 250 Jahren bewusst sein sollte, so urteilt, verwechselt er seine Gegenwart, mit der Zeit, über die er zu arbeiten vorgibt. Kant äußert sich mit keinem Wort über eine prinzipielle Differenz zwischen Schwarzen und Weißen; es wird nur gesagt, dass sie in ihrer „Gemüthsart“, also dem, was als „Geschmack“ bezeichnet wird, nicht genügen. Mit dem Vorwurf des „Läppischen“, der ein unangemessenes Betragen anzeigen soll, spart er auch bei seinen europäischen Nachbarn nicht.
3. Das klassifikatorische Problem der Race. Das zweite Themenfeld, in dem sich Kant als Rassist zu erkennen gegeben haben soll, ist die zu seiner Zeit unter großer Beteiligung vieler Autoren verhandelte Frage, nach der natürlichen Herkunft der Racen. Die im 18. Jahrhundert entstehende neue Wissenschaft von den lebendigen Wesen, für die sich erst in den folgenden Jahrzehnten der Begriff der Biologie einbürgert, hatte keine verbindliche Erklärung für des Ursprung der auffälligen äußeren Unterschiede zwischen den Menschen. Heute wissen wir, dass erst in der Folge von Darwins Evolutionstheorie eine verlässliche Erkenntnis möglich geworden ist. Und auch hier bedurfte es erst der Einsichten in die genetischen Mechanismen der Vererbung, um zu einem plausiblen Aufschluss zu gelangen.
Schon im Vorfeld seiner seit 1790 vorliegenden kritischen Theorie des Lebens, hatte Kant bloß aus vergleichenden Beobachtungen die Einsicht gewonnen, dass alle Menschen, so verschieden sie in Aussehen und Verhalten auch sein mögen, einem einzigen „Stamm“ entspringen und zu einer „Familie“ gehören. Damit hat er von Anfang an der Auffassung widersprochen, es könne fundamentale Unterschiede zwischen den Racen geben. Da sich alle Menschen, biblisch gesprochen, wechselseitig „erkennen“ und Nachwuchs zeugen können, und da sich schon im Gang weniger Generationen selbst die auffälligen Unterschiede auswachsen können, sind für Kant alle Menschen von Natur aus gleich.
Dieser in zwei Texten von 1775 und 1785 vertretenen Ansicht ist zwar einmal von Georg Forster widersprochen worden. Doch der hat, nach Kants ausführlicher Erwiderung im Jahre 1788 schnell zurückgesteckt und danach nur noch hypothetisch mit der Erwägung gespielt, es könne vielleicht doch zwei oder mehr Ursprünge des Menschengeschlechts gegeben. Dass diese Auffassung der Begründung der Sklaverei Vorschub leistet, dürfte Forster klar gewesen sein.
Für Kant haben derartige Erwägungen nie eine Rolle gespielt. Für ihn kamen Sklaverei und Leibeigenschaft ohnehin nicht in Betracht. Die Frage der Race war für ihn ein rein klassifikatorisches Problem, mit dem er Naturforscher wie Buffon, Linné oder Blumenbach auf seiner Seite hatte und für die es heute weltweite empirische Belege durch die genealogischen Genvergleiche gibt. Sie sind inzwischen durch die Untersuchung des Erbmaterials von Frühmenschen bestätigt.
Da es hier für Kant keinen Zweifel gab, standen für ihn die nachträglichen Ursachen für die Aufteilung der einen Menschheitsfamilie in mehrere Racen im Zentrum seines Interesses. Dabei kamen für ihn allein klimatische Ursachen infrage. Die hatten schon bei antiken Autoren eine Rolle gespielt, konnten mit den neuzeitlichen Entdeckungsreisen aber ungleich differenzierter beschrieben werden, so das Kant glaubte, hier den entscheidenden Grund für die Abweichungen im Aussehen und Verhalten der Menschen finden zu können. Alles Weitere hing für ihn an der eigenen Leistung des Menschen, die in der Summe zu den kulturellen Unterschieden zwischen den Menschen führen.
4. Kants Kritik am Kolonialismus und sein kategorischer Imperativ. Von Rassismus, der in Verbindung mit Kants Gebrauch des Begriffs der Race steht, kann somit keine Rede sein. Wohl aber gibt es bei ihm weiterhin die aus der Literatur übernommenen Vorurteile gegenüber „Negern“ oder Südseebewohnern. Die einen wie die anderen hält er für träge, übelriechend oder antriebsarm. Beiden spricht er einen eigenen Impuls zur Entwicklung ihrer Kultur ab, weil sie, wie er nach den vorliegenden Reisebeschreibungen annehmen konnte, über Jahrhunderte hinweg unter gleichbleibenden Bedingungen gelebt haben sollten.
Wer an diesen Aussagen Anstoß nimmt, dem kann man nur zustimmen. Kritik verdient auch, dass Kant den „Weißen“ und damit den aus Europa stammenden Menschen den Vorzug vor den Naturmenschen gibt. Er ist, wenn man so will, ein „Eurozentrist“, der sich mit seinem Eintreten für die Wissenschaften, die Vernunft und die Aufklärung bewusst und ausdrücklich zu denen rechnet, die für Moralität, Legalität, Humanität und Menschenrecht eintreten. Nur darf man nicht übersehen, dass auch die Kritik am Rassismus diese Prinzipien für sich in Anspruch nimmt! Also macht Kant es auch denen nicht leicht, die ihm seine Präferenz für die Aufklärung zum Vorwurf machen, so als sei seine Option für die Vernunft nichts anderes als ein kontinentales Vorurteil.
Eine solche Voreingenommenheit hat Kant allerdings in seinem Einverständnis mit der kolonialen Praxis der Europäer an den Tag gelegt. Erst der Freiheitskampf der Neuenglandstaaten gegen die europäische Kolonialmacht hat ihn eines Besseren belehrt. In Königsberg war er als Parteigänger der aufständischen Amerikaner verschrien wie später auch in seiner Begeisterung für die Französische Revolution. Von da an hat er die koloniale Praxis mit Entschiedenheit verurteilt, und das von ihm erstmals 1795 exponierte Weltbürgerrecht, das jedem Menschen unabhängig von seiner Herkunft zusteht, hat das vorrangige Ziel, eine erschlichene Landnahme durch auswärtige „Gäste“ unmöglich zu machen. Mit seinem Eintreten für das Menschen- und für das Weltbürgerrecht optiert Kant somit nicht nur für die rechtliche Gleichheit aller Menschen auf der Erde; er möchte auch die Ausbeutung unterlegener Staaten unterbinden. Ob er damit tatsächlich ein wirksames Mittel gegen den Sklavenhandel in Vorschlag bringt, ist leider wenig wahrscheinlich. Die Sklavenhändler betrieben ihr Geschäft nicht selten mit Angehörigen ihres eigenen Volkes.
Schließlich sollte jeder, der Kant „Rassismus“ vorwirft, daran denken, das dieser Philosoph die Moral, die unterschiedslos für alle Menschen gilt, in eine Formel fasst, die eben diese Gleichheit aller Menschen zum Prinzip des sittlichen Handelns erklärt: „Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person, als auch in der Person eines jeden andern jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst.“ (4, 429) Selbst wenn Kants Äußerungen vor dieser erstmals 1785 gedruckten Formulierung seines kategorischen Imperativs dem Rassismus nahe gekommen sein sollten, verbietet es die Achtung vor der Leistung seines Denkens, das in seiner Ethik eine fortwirkende philosophische Fassung gefunden hat, ihn pauschal als „Rassisten“ zu bezeichnen.
5. Die Rolle der Kultur. Rassist ist Kant also in keiner Hinsicht. Und dass es sich gleichermaßen verbietet, ihm als einem Exponenten der europäischen Aufklärung die inhumane Parteilichkeit eines Eurozentristen vorzuwerfen, zeigt seine Kulturtheorie, in der er versucht Natur und Vernunft zu verbinden. In einem Aufsatz, den flüchtige Leser irrtümlich für einen Rückfall in die Theologie gehalten haben, entmythologisiert Kant die biblische Schöpfungsgeschichte, um so den Mangel an frühgeschichtlichen Zeugnissen zu kompensieren. Dabei ist er frei von allen kontinentalen und religiösen Optionen, wenn auch nicht frei von Ironie gegenüber seinem durch die Ungunst der Überlieferung erzwungenen literarischen Kunstgriff. Den führt er uns in seiner Abhandlung Muthmaßlicher Anfang der Menschengeschichte von 1786 vor. Hier deutet Kant den Sündenfall Evas als ersten Akt in einer Kulturgeschichte der Menschheit:
Die ersten Menschen, so setzt er voraus, konnten stehen, gehen, sprechen und denken, und sie verfügten bereits über mancherlei technische Geschicklichkeit. In alledem stehen sie den Tieren noch sehr nahe. Der initiale Schritt in die humane Selbständigkeit erfolgt hingegen, wenn sie die instinktive Furcht vor den als unverträglich geltenden Speisen überwinden und von den ihnen bislang durch ihre leibliche Disposition versperrten „verbotenen“ Früchten essen. Auch wenn sich die neuen Speisen vielleicht nicht gleich als wohlschmeckend und bekömmlich erweisen, so ist damit doch die Chance eröffnet, „sich selbst eine Lebensweise auszuwählen“ (8, 112). So befreiten sich die ersten Menschen aus der „Vormundschaft der Natur“, ohne dabei ihren Charakter als Naturwesen zu verlieren.
Das belegen auch die weiteren Akte der Selbstbefreiung des Menschen im Übergang zu einer eigenständigen kulturellen Existenz. Sie werden ebenfalls von Kant in Anlehnung an die Schöpfungsgeschichte beschrieben: Da ist zunächst die Geschichte mit dem „Feigenblatt“, durch das es dem Menschen gelingt, den „Instinct zum Geschlecht“, gleichermaßen zu hemmen und zu steigern: „Weigerung“, so sagt Kant, „war das Kunststück, um von bloß empfundenen zu idealischen Reizen, von der bloß thierischen Begierde allmählich zur Liebe und mit dieser vom Gefühl des bloß Angenehmen zum Geschmack für Schönheit“ und schließlich zur „Sittsamkeit“ zu gelangen (8, 113). Das sei zwar nur ein „kleiner Anfang“ gewesen, der aber doch „Epoche“ gemacht und schließlich zur „Cultur“ geführt habe.
Der dritte Schritt ist auf die Vertreibung aus dem Paradies bezogen, die den Menschen mit ungewissem Ziel in seine eigene Zukunft entlässt: Hier fordert sich die Vernunft selbst durch die „überlegte Erwartung des Künftigen“ heraus und macht dem Menschen seine Sterblichkeit bewusst. Damit beginnt nicht nur die eigene Sorge um das Kommende, sondern auch die Einstellung auf den jeweils eigenen Tod. Dazu gehört alles, was zur gemeinschaftlichen Selbsterhaltung zu rechnen ist, aber eben auch der Totenkult und die Religion, die beide, wie wir heute wissen, für die kulturelle Entwicklung der Menschen von einiger Bedeutung sind.
Der vierte und letzte Schritt, den Kant mit offenkundiger Unerbittlichkeit schildert, kann heute vielleicht besser als je zuvor als Härtetest der menschlichen Vernunft angesehen werden: Denn die Vernunft muss einsehen, dass sie die Natur, aus der sie stammt und zu der sie weiterhin gehört, für ihre eigene Erhaltung immer auch – zerstören muss. Damit ist freilich noch nicht die Umweltzerstörung gemeint. Kant spricht lediglich, wenn auch ohne Rücksicht auf das Zartgefühl seiner Leser, von der Tötung, Häutung und Zerlegung der Tiere, die unvermeidlich ist, wenn der Mensch selbst leben will (8, 114). In seiner zehn Jahre später verfassten Metaphysik der Sitten leitet Kant aus eben diesem brachialen Einsatzmenschlicher Übermacht, die moralische Verpflichtung ab, die Tiere nicht sinnlos leiden zu lassen (6, 443).
6. Die Einheit der Menschheit. Wenn Kant schreibt, mit dem immer auch aus eigener Kraft bewältigten Übergang zur Kultur erfolge die „Entlassung“ des Menschen „aus dem Mutterschoße der Natur“ (8, 114), darf das nicht so verstanden werden, als sei der Mensch zum bloßen Kultur- oder gar zum reinen Vernunftwesen geworden. Der Mensch bleibt vielmehr, so kultiviert und zivilisiert, so moralisiert und politisiert er sein mag, immer auch Teil der Natur. Die verschiedenen Felder menschlichen Erlebens müssen als getrennt gedacht und jeweils für sich verstanden werden. Aber dass sie dennoch aus einem einheitlichen Ursprung stammen können, das zu zeigen, ist die große systematische Leistung der kritischen Philosophie.
Viele Kritiker Kants, und vielleicht auch einige seiner Anhänger, haben das bis heute nicht erkannt. Und so machen sie ihm noch in der jüngsten Rassismusdebatte sein angeblich rein instrumentelles Naturverständnis auf der einen und seinen Menschheitsidealismus auf der anderen Seite zum Vorwurf, ohne zu sehen, dass gerade mit dem Humanismus Kants der innere Zusammenhang von Natur, Kultur, Vernunft, Moral und Recht unabweisbar wird: Wie anders sollte es den Menschen geben, wenn nicht als Naturwesen, das geboren wird und wieder sterben muss? Wie sollte er sich als das Tier, dass er von Natur aus ist und bleibt, von anderen Lebewesen unterscheiden, wenn nicht durch eigene Anstrengungen, die ihm ein Leben unter eigenen kulturellen Bedingungen ermöglichen? Wie sollte er seine Würde wahren, wenn nicht unter Bezug auf die Menschheit, ohne die sich gar nicht verstehen ließe, was „Würde“ bedeutet? Und was bliebe dem Menschen überhaupt zu tun übrig, wenn er nicht hoffen könnte, durch politisches Handeln in Gemeinschaft mit seinesgleichen sowohl etwas für die Wahrung seines Erbes wie auch für die Sicherung seiner Zukunft zu tun?
In seiner dritten Kritik von 1790 hat Kant, wie gesagt, eine Theorie des Lebens entwickelt, die in eine Theorie der Kultur mündet, und zugleich den möglichen Übergang zu einem kritisches Gottesverständnis freilegt. Der Philosoph schließt damit eine doppelte Lücke, die er in seiner ersten selbständigen Schrift, der Allgemeinen Naturgeschichte und Theorie des Himmels von 1755 gelassen hatte. Damals hatte er behauptet, der Mensch und sein Geist seien im Lauf von Jahrmillionen aus denselben physikalischen Kräften hervorgegangen, die auch die Sonnensysteme, die Planeten und alles Lebendige, das sich auf ihnen befindet, möglich machen. Buchstäblich alles ist hier eine Folge der Wechselwirkung physikalscher Kräfte, einschließlich der Verse von Alexander Pope und Albrecht von Haller, mit denen Kant seine Kapitel ziert. Und Gott wird nur gebraucht, um die „Materie zu geben“, damit überhaupt etwas ist (1, 220).
Aus dieser mechanischen Weltmaschine von 1755 ist 1790 ein sich selbst organisierendes Ganzes geworden, eine lebendige Einheit der irdischen Natur, in der die Menschen allererst ihren Sinn und ihren Wert zu finden vermögen. Die hier skizzierte Evolution des Lebens beruht auf der durchgängigen „Selbstorganisation“ aller Lebewesen, die sich im unablässigen Austausch sowohl mit den umgebenden Bedingungen wie auch im Umgang mit ihresgleichen bilden. Erst dabei entsteht die Vielfalt der Gattungen und Arten aller Lebewesen.
Der Mensch macht hier keine Ausnahme. Durch unterschiedliche Ursachen, zu denen auch eine habituelle „Unverträglichkeit“ gehört, sah sich der Mensch genötigt, sich über den ganzen Erdball auszubreiten. Und die Vielfalt der Lebensbedingungen, die er sich aus eigenem Antrieb und allemal auch durch eigene Leistung erschlossen hat, spiegelt sich nach Jahrtausenden der Trennung von einander, nunmehr in Aussehen und Verhalten der Menschen wider.
So lesen wir es in Kants Friedensschrift von 1795. Und hier findet sich auch seine politische Diagnose: Die Erde ist zu klein geworden, um es den Menschen zu ermöglichen, weiterhin vor einander auszuweichen. Und die „höllischen Künste“ ihrer Kriegstechniken erlauben es ihnen nicht länger, fortgesetzt im Kriegszustand zu leben. Deshalb sind sie, wenn sie denn vernünftig sind, genötigt, in einer alle Menschen umfassenden rechtlichen Ordnung zu leben, die jedem Menschen Freiheit, Gleichheit und Öffentlichkeit garantiert.
Diese Vision kann nicht von einem „Rassisten“ stammen, so groß die gelegentlichen sprachlichen Missgriffe des Autors auch gewesen sein mögen. Die Missgriffe können als Ausdruck korrekturbedürftiger Vorurteile gegenüber weißen wie gegenüber schwarzen Menschen gewertet werden. Sobald aber von den Menschen überhaupt die Rede ist, werden sie sowohl von Natur aus wie auch in moralischer Absicht als Einheit angesprochen.