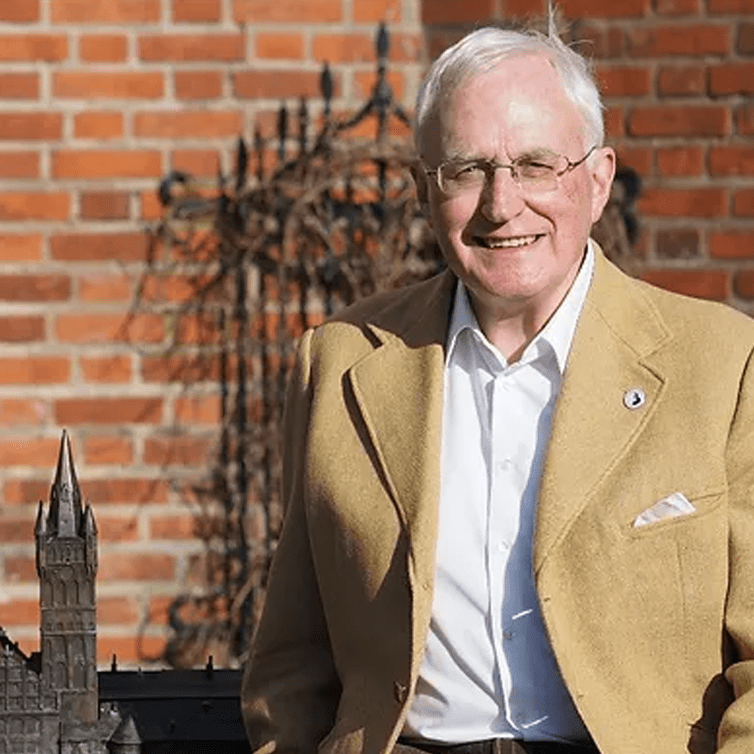Rede des Bohnenkönigs Assessor iur. Klaus-M. v. Keussler gehalten im Deutsch-Russischen Haus in Königsberg/Kaliningrad am 22. April 2013
Die russische Besetzung Ostpreußens (1758 – 1762): …..und was macht Kant?
• Lieber Boris als Vorsitzender der „Gesellschaft der Freunde des Bohnenkönigs“
• Lieber Gerfried als Vorsitzender der „Gesellschaft der Freunde Kants und Königsbergs“
• Sehr geehrter Herr Generalkonsul Dr.Krause
• Lieber Andrej als Direktor des Deutsch-Russischen Hauses
• Liebe Freunde
Mit Freude trete ich heute vor Sie.
Es bewegt mich, dass ich als Bohnenkönig in meiner Geburtsstadt Königsberg zu Ihnen sprechen darf. Dort, wo sich heute ein Stadtgericht Kaliningrads in der Uliza A. Newski 29 befindet, habe ich – in der damaligen Cranzer Allee 29 – glückliche Kinderjahre verbracht.
Die Beziehungen meiner Vorfahren zu Russland sind vielfältig gewesen.
Als 1907 die Stadt St. Petersburg die erste elektrische Straßenbahn auf dem Newski-Prospekt in Betrieb nahm, wurde mein Vater ganz in der Nähe geboren. Er ging dort mehrere Jahre zur Schule.
Sein Vater – mein Großvater – war schon seit 1886 nach St. Petersburg gekommen. Er unterrichtete als Oberlehrer an der St. Petri Schule und an der St. Annen Schule mehr als 27 Jahre. Während dieser Zeit heiratete er eine Schülerin – sie wurde meine Großmutter. Auch mein Großvater mütterlicherseits unternahm als Journalist und Volkstumspolitiker ausgedehnte Reisen durch ganz Russland und publizierte darüber.
Dies geschah ca. 150 Jahre nach der ersten Besetzung Ostpreußens durch die Russen!
*
22. Januar 1758
Es ist bitterkalt an diesem 21. Januar 1758. In Pelze gehüllt und auf Pferdeschlitten begibt sich eine dreiköpfige Schar von Würdenträgern der Stadt Königsberg zum Schloss in Caymen (heute: Saretschje), nicht weit von der Kreisstadt Labiau entfernt. Die Deputation des Königsberger Magistrats, unter ihnen der Bürgermeister Hindersin, ist ermächtigt, mit General Wilhelm von Fermor (1702 – 1771), dem Oberbefehlshaber der Russisch Kaiserlichen Truppen und Memel-Eroberer, die kampflose Kapitulation der Provinz Preußen zu verhandeln.
Es war absehbar, dass der Vorstoß der zaristischen Truppen unter Feldmarschall Stefan F. Apraxin (1702 – 1758) mit seinen etwa 60000 Mann in den letzten Monaten nicht mehr aufzuhalten war. Der preußische König Friedrich II (1712 – 1786) war finanziell und militärisch in Schlesien und Sachsen ausgeblutet. Das wegen der schwierigen Verkehrsverbindungen entlegene – nur durch beschwerliche und zeitraubende Reisen erreichbare – Ostpreußen war auf sich allein gestellt. Der Preußenkönig hatte ohnehin von der Provinzhauptstadt Königsberg nur eine eher geringschätzige Meinung, mit der er schon als Kronprinz nicht hinter dem Berg hielt:
„Müßiggang und Langeweile sind, wenn ich nicht irre, die Schutzgötter von Königsberg, denn die Leute, die man hier sieht, und die Luft, die man hier atmet, scheinen nichts anderes einzufößen!“ [1]
Im Angesicht des heranrückenden Feindes wurden behördliche Akten und Archive, die königlichen Kassen, das Kirchensilber sowie Bestände der Königlichen Bibliothek schon Ende 1757 von Königsberg nach Küstrin verfrachtet. Eine eiligst ausgehobene Bürgerwehr, u.a. aus Fleischern, Handwerksgesellen, Brandweinbrennern und Fuhrleuten – bewaffnet mit Musketen, aber auch mit Sensen, Heugabeln und Forken – sollte notfalls die acht Kompanien des Königsberger Regiments unterstützen.
Am 14. Januar 1758 verlässt das Königsberger Militär die Stadt in Richtung Pommern. Die Munition und Waffen sowie Vorräte werden, soweit sie nicht mitgenommen werden können, in den Pregel versenkt. Höhere Regierungsbeamte, unter ihnen die wichtigsten Männer im Etatministerium (Finanzministerium), fliehen mit zahlreichen Einwohnern nach Danzig und Elbing.
Während der Kapitulationsverhandlungen am 21. Januar stellen die Deputierten Königsbergs mit dem Mute der Verzweifelung einige Forderungen zur Aufrechterhaltung bestehender Rechte und Privilegien.
Dies wird von russischer Seite später als „dreist“ bezeichnet. General v. Fermor, ein in Russland geborener Schotte von weltmännischer Erziehung, erweist sich als entgegenkommender Verhandlungspartner.
Allerdings wünscht er sich ganz entschlossen – aus Eitelkeit? aus Frömmigkeit ? -, bei seinem Einzug in Königsberg mit Glockengeläut empfangen zu werden.
Und so geschieht es.
Am 22. Januar, es war ein Sonntag, rücken morgens um sieben Uhr die ersten Vorauskommandos zu Pferde und zu Fuß in Königsberg ein: Kosaken, Grenadiere und „andere Völker“. Um die Mittagszeit versammeln sich die Königsberger Kriegskammer, das Hofgericht, der Magistrat, die Collegien und die Universität im Schloss. Gilden und Gewerke bilden vor dem Stadtschloss ein Spalier. Alle Kirchenglocken läuten. Vom Schlossturm hört man Pauken und Trompeten. General v. Fermor – wie ein Fürst in einem roten mit Gold besetzten Pelz und dem Blauen Band mit dem Weißen Adlerorden aufwändig gekleidet – nimmt gegen drei Uhr feierlich die königlichen Gemächer in Beschlag. Der fast blinde preußische Feldmarschall Johann v. Lehwaldt (1685 – 1768) hatte sie eiligst frei gemacht. Die preußischen Behördenvertreter, an ihrer Spitze der nach der Flucht seiner Kollegen allein verbliebene Präsident des Etatministeriums v. Lesgewang sowie die Deputationen des Adels und der Bürgerschaft überreichen v. Fermor die Schlüssel der Stadt. In seiner ersten Ansprache versichert der General, ein langer hagerer Mann mit blassem, von Pockennarben zerrissenem Gesicht, den Versammelten, man könne sich Glück wünschen, dass die Kaiserin die Stadt in ihren Schutz nehme, und, wenn die Provinz ihren Verpflichtungen nachkomme, sie unter dem sanften Zepter der Kaiserin nichts zu befürchten habe.[2]
Zwei Tage später – es ist von russischer Seite bewusst der Geburtstag Friedrich II ausgewählt – müssen zunächst die obersten Behörden des Landes und des Magistrats sowie die Repräsentanten des Adels und der Bürgerschaft den Huldigungseid auf Ihre Majestät Zarin Elisabeth Petrovna, Kaiserin und Herrscherin aller Reußen leisten. Am nächsten Tag, es ist der 25. Januar 1758, werden die Professoren und Magister sowie die übrigen Angehörigen der Universität in die Schlosskirche gerufen. Der Hofprediger Dr. Daniel Heinrich Arnoldt (1706 – 1775) liest im Beisein des russischen Generals Nothelfer den vor dem Altar Versammelten den Huldigungstext vor. Sämtliche Professoren und anschließend die übrigen Collegia haben sodann mit erhobenen drei Fingern und unter der Beteuerung „So wahr mir Gott an Leib und Seele helfe“ den Eid zu leisten und „Mann für Mann ihre Namen auf einem Bogen Papier“[3] zu schreiben.
Und was macht Kant?
*
Kant – der junge Magister legens (Privatdozent)
Auch Kant, 33 Jahre alt, unterschreibt an diesem denkwürdigen Januartag ebenso wie seine Universitätskollegen das ihm vorgelegte Vereidigungsformular.
Er gehörte nämlich schon zu diesem Zeitpunkt zum Lehrkörper der Philosophischen Fakultät der Albertina. Am 12. Mai 1755 war er mit seiner Promotionsschrift „De igne“ (Über das Feuer) zum Magister der Philosophie promoviert worden. Monate später erhielt er durch weitere Schriften die Lehrbefugnis (venia legendi) und brachte schließlich die vom Preußenkönig verordneten wissenschaftlichen Voraussetzungen – drei öffentliche Disputationen – zum Erwerb eines Extraordinariats bei.
Seit dem Wintersemester 1755/56 lehrte Kant als Magister legens (Privatdozent) Logik, Mathematik, Physik, Metaphysik und Ethik. Sein daneben laufendes Bemühen war es, Professor an der heimischen Universität zu werden. Dieses Ziel hatte er mit den selbstbewussten Worten unterstrichen:
“Ich habe mir die Bahn schon vorgezeichnet, die ich halten will. Ich werde meinen Lauf antreten und nichts soll mich hindern, ihn fortzusetzen.“[4]
Und so hatte er sich schon nach nur einem Semester Lehrtätigkeit – als „Ew. Königl: Majestät allerunterthänigster Knecht“ – im April 1756 bei Friedrich II um das seit Jahren verwaiste Extraordinariat für Logik und Metaphysik seines wohl wichtigsten Universitätslehrers Prof. Martin Knutzen (1713 – 1751) beworben. Allerdings – der preußische König war nicht bereit, die Mittel für die vakante Professorenstelle zu bewilligen, er brauchte das Geld für seine militärischen Ambitionen.
Soldaten waren ihm wichtiger als Metaphysiker!
Von Anfang an begleitete Kant ein starkes Interesse der Studentenschaft. Nach der Erinnerung seines Schülers und Biographen Ludwig Ernst Borowski (1740 – 1832) war bei Kants erster Vorlesung eine “beinahe unglaubliche Menge von Studierenden anwesend“ – es waren zwischen 18 – 20 Studenten, überwiegend der Theologie, darunter sein Bruder Johann Heinrich (1735 – 1800) und 7 Schlesier! Buntgewürfelt war der Kreis der Studenten. Preußen und Ausländer, vor allem Kurländer, Russen und Polen, kauerten im Laufe der Jahre zu seinen Füßen. Kants Vorlesungen, durchschnittlich nicht unter 16 Wochenstunden, waren häufig schwierig und anspruchsvoll. Sie waren aber alles andere als pedantische Einübungen in die damals üblicherweise vorgetragenen Lehrmeinungen anderer Philosophen und Theologen.
Immer wieder warnte Kant seine Studenten vor bloßer Nachbeterei, immer wieder schärfte er ihnen ein: Selbst denken, selbst forschen, auf eigenen Füßen stehen!
*
Russen in Königsberg
Für die nun beginnende fast fünfjährige russische Besetzung (1758 – 1762) wurde der kaiserlich Ukas am 19. Februar 1758 die wesentliche Grundlage. Nach ihm sollte die Stadt Königsberg mit ihren „Privilegien, Freyheiten, Gerechtsamen und Praerogativen“ geschützt werden[5].
Das Privateigentum blieb unangetastet, die Religionsfreiheit und die Durchführung öffentlicher Gottesdienste wurden weitgehend uneingeschränkt gestattet. Regierungs- und Verwaltungsbeamte blieben bei gleichen Bezügen in ihren Funktionen – mit Ausnahme der oberen Bediensteten im Etatministerium. In den Schlüsselstellungen der Verwaltung wurden russische – meist wirkungslose – Aufsichtsbeamte, manche mit brauchbaren Deutschkenntnissen, eingesetzt. Niemand wurde gezwungen, in den russischen Dienst einzutreten. Die Freiheit des Binnen- und Außenhandels – unter ausdrücklicher Zusicherung des Schutzes durch die kaiserliche Flotte – wurde ebenso wie der Post- und Reiseverkehr nach Ost und West gewährleistet.
Überall dort, wo der preußische Adler als das sichtbare Zeichen hoheitlicher Macht gegenwärtig war, wurde er ersetzt durch den kaiserlichen Doppelaar. Einige Behörden suchten sich damit zu behelfen, dass sie das „Königlich“ in „Königsbergisch“ umwandelten. Die Russische Freiertage, 13 an der Zahl, wurden eingeführt und mussten aufwändig zelebriert werden. Die Zarin und das „allerhöchste Haus“ mussten in das sonntägliche Gebet eingeschlossen werden. Die mit Hilfe der Königsberger Münze hergestellten Geldstücke zeigten auf der Vorderseite das Bild der Zarin, den Doppeladler oder die verschlungenen Buchstaben E.P. (Elisabeth Petrovna).
Natürlich hatte die besetzte Provinz die Lasten von zusätzlichen zum Teil erheblichen Kontributionen zu tragen, von denen Königsberg allein ein Drittel aufzubringen hatte. Doch wenn die Belastungen einmal zu groß wurden, reiste eine Delegation nach St. Petersburg – und dort ließ man durchaus mit sich reden. Die Zarin, wiewohl eine unversöhnliche Gegnerin Friedrich II, wollte die Einwohner des besetzten Landes schrittweise für sich gewinnen, damit
„…die Erinnerung an unsere Großherzigkeit und Milde für immer erhalten bleiben möge“.[6]
Die Academie – die Universität Albertina – erfreute sich von Anfang an einer wohlwollenden Behandlung durch die Russen.
Die Lehrenden und Lernenden konnten uneingeschränkt alle ihre Freiheiten und Vorzüge weiter nutzen. Die Studenten durften ihre Studien fortsetzen und ihre akademischen Privilegien, z.B. die Befreiung vom Militärdienst, behalten. Und besonders wichtig war: der Universität blieben die angestammten Einkünfte erhalten. Allerdings wurde den Philosophie-Professoren die bisherige Zensur-Zuständigkeit beschnitten. Bisher war die Zensur eine Angelegenheit des jeweiligen Rektors und des Dekans der Philosophischen Fakultät. Die Zensur bildete gleichsam einen Akt der akademischen Disziplinargewalt, da Buchdrucker und Buchhändler der Gerichtsbarkeit der Universität unterworfen waren. Der Senat machte daher, als v. Fermor die Zensur der Presse in eigene Hände nehmen wollte, seine bisherigen Rechte geltend – nicht ohne auch die befürchtete Einbuße von Zusatzeinkünften (Gebühren) anzumerken. Doch Fermor überließ der Universität nur die Befugnis zur Zensur wissenschaftlicher Arbeiten.
Demgegenüber erfuhr die juristische Fakultät der Universität eine bedeutende Beförderung: sie wurde zum obersten Kassationshof mit richterlichen Funktionen für die Provinz Preußen bestimmt, nachdem die Appellation an das Geheime Obertribunal in Berlin in Fortfall geraten war.
*
Die Anwesenheit der Russen in Königsberg trug maßgeblich dazu bei, dass sich der Lebensstil, das kulturelle Klima und die gesellschaftlichen Verhältnisse in dieser so streng pietistisch geprägten „alten zopfigen Stadt„[7]veränderten.
Dafür gab es mehrere Gründe:
Die Russen brachten viel Geld unter die Bevölkerung der Stadt. Händler, Gewerbetreibende und Getreidelieferanten für die russische Armee kamen zu großem Reichtum – allen voran der Kaufmann und Mäzen Friedrich Franz Saturgus (1728 – 1810). Für die Reparatur der morschen Festungsanlagen und die Vertiefung des versandeten Seegatters in Pillau wurden einheimische Fachkräfte gebraucht. Also stellte Gouverneur Fermor die Summe von 1000 Rubel zur Verfügung. Der Schleichhandel mit bisher verbotenen Waren (Spirituosen, insbesondere Wodka) florierte und der locker sitzende Sold der Militärs floss in die Taschen der Königsberger.
Für den sich wandelnden Lebensstil waren in erster Linie die mit guten Deutschkenntnissen ausgestatteten Gouverneure der Provinz tonangebend: General v. Fermor bis März 1758 und ab Juli 1758 der Balte General Nikolaus Freiherr v. Korff (1710 – 1766), dessen Frau, geb. Skawronska, eine Cousine der Zarin Elisabeth war. Fermor und Korff waren in der Bevölkerung wegen ihres verbindlichen Wesens durchaus beliebt. Sie und ihre Offiziere, aber auch russische Edelleute in der Stadt scherten sich nicht um die Etikette der Stände und Cliquen und lebten gehobene gesellschaftliche Umgangsformen vor. Die krassen Unterschiede zwischen Adel und Bürgerlichen wurden „ziemlich platt und glatt“[8] getreten. Charmeoffensiven bestimmten das Miteinander.
„…Die große Mehrzahl derselben suchte und kannte die Genüsse gesellschaftlicher Vereinigung nur in dem aufregenden Wechsel…oder in den schwelgerischen Freuden der Tafel, die jüngere Generation in den rauschenden Wogen des Ballsaales und dem üppigen Spiele einer frivolen Galanterie.. .. Für die Damen der höheren Stände war dieser Umschwung eine Art von Emanzipation aus der fast klösterlichen Zucht…“[9]
Französische Cuisine und ein Flair wie in den Pariser Salons erfreute die Gäste in den Häusern der Reichen und Schönen. Es verbreitete sich zunehmend das Punsch- und Teetrinken. Maskenbälle, Redouten und Hochzeiten zwischen russischen Offizieren und preußischen Damen brachten Leben in den gesellschaftlichen Alltag Königsbergs. Die strengen Sitten lockerten sich.
„Die pedantische Strenge einer fast abgeschmackten Prüderie begann einem freieren Anstandstone zu weichen.“[10]
Russischer Luxus und Libertinage vertrieben die preußische Kargheit und den pietistischen Ernst.
„Königsberg wurde ein zeitvertreibender Ort und die Liberalität, mit welcher die damaligen Gewalthaber alles, was schön und artig war und dafür gelten wollte, zu ihren Freundeskreisen zu ließen, machte, dass das schöne Geschlecht sich besonders für die interessierte… Zu den Bällen, die das Gouvernement stets auf eigene Kosten gab, wurden die Damen nicht frankenartig requirirt, sondern durch galante, flinke, wohlaussehende Adjutanten…eingeladen.[11]
Das war schon bemerkenswert:
Während man in Königsberg die Töchter mit den russischen Offizieren tanzen und poussieren ließ, schickte man woanders die Söhne gegen die Russen ins Feld!
Auch die Universität beteiligte sich nolens volens – meist aus Anlass russischer Staatsfeste, z. B. am Krönungstag der Kaiserin – mit eigenen feierlichen Veranstaltungen in der Aula am gesellschaftlichen Leben. Überschwängliche Reden in Prosa und Poesie wetteiferten miteinander.
Die Huldigungsreden (Carmina) der Professoren Johann Georg Bock (1698 – 1762) und Mathias Friedrich Watson sollen sich durch eine geradezu servile „Liebedienerei“[12] ausgezeichnet haben. Zu diesen Feiern erschienen regelmäßig die Gouverneure höchstpersönlich – mit einigen Offizieren im Gefolge, um vielleicht vor den Augen der deutschen Bevölkerung ihren Respekt vor wissenschaftlicher Bildung sichtbar zur Schau zu tragen. Der Besuch der akademischen Festakte wurde für die vornehme Damenwelt geradezu eine Modesache.
Eine gewisse Wende trat ein, als später General W. I. Suworow (1730 – 1800) Gouverneur wurde. Dieser als geizig verschriene Offizier gab nur noch hin und wieder Bälle für seine beiden Töchter. Die rauschenden Feste seines Vorgängers Korff hörten allmählich auf.
Alles in allem: Königsberg blieb für jeden Reisenden eine höchst anziehende Zwischenstation auf dem Weg von Berlin nach St. Petersburg und zurück.
Und was macht Kant?
*
Kant – einerseits und andererseits
Kants Tagesablauf zerfiel mehr oder weniger in zwei Hälften. Der Morgen und der Vormittag gehörten der wissenschaftlichen Arbeit und dem akademischen Unterricht. Am Nachmittag und Abend nahm er im Kreise von engen Freunden und Bekannten am gesellschaftlichen Leben Königsbergs teil.
*
Mit der ihm eigenen Pünktlichkeit und Disziplin, jener „Kraft, das für richtig Gehaltene auch zu tun“, hielt Kant wie in den vergangenen Jahren regelmäßig seine Vorlesungen – im Sommersemester von Ende April bis Mitte September, im Wintersemester von Mitte Oktober bis Ende März. Angesichts der zahlreichen – zum Teil bis zu 24 – Wochenstunden war die Arbeitsbelastung enorm. Seine Stimmungslage zu den stets „sich selbst ähnlichen Vorlesungen„ skizzierte Kant in einem Brief (1759) an seinen Freund Johann Gotthelf Lindner (1729 – 1776), den Rektor der Rigaer Domschule: er bearbeite täglich – wie ein Schmid – sein Werk auf dem Amboss mit gleichförmigen schweren Hammerschlägen.[13]
Es gehörte im Königsberg des 18. Jahrhundert zu den Universitätsusancen, dass lediglich die Lehrveranstaltungen der Professoren im gedruckten lateinischen catalogus lectionis (Lektionsverzeichnis) angekündigt wurden. Die Privatdozenten mussten demgegenüber durch Aushang am „Schwarzen Brett“ auf ihre Vorlesungen und Übungen, deren Auswahl ihnen weitgehend freigestellt war, hinweisen. Daneben konnten sie mittels so genannter „Programmschriften“ auf Inhalt und Art der Lesungen öffentlich aufmerksam machen, um so das Interesse der Studierenden zu wecken. Kant hat verhältnismäßig häufig diesen Weg gewählt.
Von der Universität bezog Kant kein Gehalt, sondern war auf die Hörergebühren angewiesen, die er von den Studenten seiner Vorlesungen einnahm. Der spätere Philosophie-Ordinarius Christian Jacob Kraus (1753 – 1807) wird zur finanziellen Lage der Lehrkräfte nüchtern feststellen:
„Wer sich der Königsberger Universität widmet, legt ein Gelübde der Armut ab!“[14]
Seit der russischen Besetzung kamen für Kant weitere Einnahmen hinzu.
Die bildungsbeflissenen Gouverneure Fermor und Korff schickten ihre Offiziere per dienstlichen Befehl in Kants Vorlesungen und besserten so die finanzielle Lage des Magisters auf. Den Vorlesungsbesuch der russischen Offiziere kommentierten manche schnippisch, dass
„ man in jenen Kreisen, denen das Wesen der Geistesbildung fremd blieb, es liebte, mit dem Scheine derselben zu paradieren!“[15]
Auch soll Kant Privatunterricht an russische Offiziere, insbesondere wenn sie Deutsche waren, erteilt haben – in Mathematik, physische Geographie sowie in Fortifikation, Architectura militaris und Pyrotechnik – eine Nebentätigkeit, die, wie Kant einräumte, gut bezahlt wurde. Als beliebter und zunehmend bekannter Dozent erzielte er allmählich ein solides Einkommen, das ihm gestattete, ein standesgemäßes Leben zu führen. Es war offensichtlich zu dieser Zeit (1761), dass Kant seinen ersten und langjährigen Bediensteten, den verabschiedeten Soldaten Martin Lampe (1734 – 1806) aus Würzburg einstellen konnte.[16]
*
Kant ging gerne nach Beendigung seiner Vorlesungen in ein Kaffeehaus – etwa zu „Gerlach, einem Billardhaus im Kneiphof in der Nähe seiner Wohnung“, um eine Tasse Tee zu trinken, sich über die Tagesereignisse zu unterhalten oder sein geliebtes Billardspiel zu spielen, bei dem er „selten ohne Gewinn nach Hause“ ging. Er liebte gutes Essen und Trinken (aber kein Bier!), so dass ihn der spätere Bürgermeister von Königsberg, Theodor Gottlieb v. Hippel (1741 – 1796), einmal necken wird, er, Kant, werde wohl noch eine Kritik der Kochkunst schreiben.
Als Mann mit feinem savoir-vivre nahm er rege an dem munteren Treiben in den Privathäusern, bei offiziellen Tischgesellschaften oder in den Offizierskasinos – trotz seiner grundsätzlichen Abneigung gegen alles Militärische – teil. Anders als zu früheren Zeiten wurde die geistige Elite der Universität während der russischen Besetzung ebenfalls zu den offiziellen Empfängen und Festen gebeten – eine Ehre, die den damaligen Professoren von Seiten preußischer Militärs nicht zuteil wurde! Auch wäre Kant weiterhin gerne zu den Vorstellungen des Konrad Ernst Ackermann, dem Erbauer und Betreiber des ersten Schauspielhauses in Königsberg (1753), gegangen, wenn dieser nicht Königsberg beim Einmarsch der Russen fluchtartig verlassen hätte! Kant verbrachte manchen Abend auch bei einer Partie L´Hombre. Dieses komplizierte und schwierige Kartenspiel zu Dritt, zu dem wesentlich das wechselseitige „Reizen“ gehört, hielt er nicht nur für eine sinnvolle Übung des Verstandes, sondern auch der Selbstbeherrschung.[17] Kant gab dieses Spielen später auf, als er den englischen Kaufmann Joseph Green (1726 – 1786) kennen lernte, der ein enger Vertrauter Kants wurde.
Bei den gesellschaftlichen Ereignissen brillierte Kant mit bestechender Intelligenz, ausgezeichneter Belesenheit und geistvollem Witz. Auf seine äußere Erscheinung legte er gesteigerten Wert. Er entwickelte sich in dieser Zeit zu dem viel zitierten „eleganten Magister“[18].
„ Ein Narr in der Mode ist besser als ein Narr außer der Mode“
pflegte er zu sagen.[19] Er trug, so schildert ihn sein zweiter Biograph Reinhold Bernhard Jachmann (1767 – 1843), einen kleinen dreieckigen Hut, eine blondhaarige, weißgepuderte Perücke mit einem Haarbeutel; eine schwarze Halsbinde und ein Oberhemd mit einer Halskrause und Manschetten; ein mit Seide gefüttertes Kleid, mit feinem, gewöhnlich schwarz, braun und gelb meliertem Tuche. Seine Schuhe waren mit silbernen Schnallen versehen. Bei besonderen Anlässen trug Kant auch einen Kavaliersdegen, den er später gerne, als es nicht mehr Mode war, „als ein ihm lästiges und sehr entbehrliches Anhängsel“[20] ablegte und durch ein Rohrstöckchen ersetzte.
Kant wurde schon bald ein gern gesehener und begehrter Gesprächspartner in den anspruchsvollen Zirkeln der Königsberger Oberschicht. Wo Kant war, „herrschte eine geschmackvolle Geselligkeit“.[21] Im Salon der überdurchschnittlich gebildeten Charlotte Amalie Gräfin von Keyserling (1729 – 1791), eine „Zierde ihres Geschlechts“, die auch das erste aller Kant-Portraits zeichnete, erhielt er regelmäßig einen Ehrenplatz. Ebenso flirtete mit Kant die schöne und in Königsberg umworbene Maria Charlotta Jacobi (1739 – 1795): die 23Jährige, in der Stadt die „Prinzessin“ genannt, versprach ihm ein für ihn gefertigtes Degenband und übersandte ihm, dem „großen Philosophen“, in einem Brief 1762 einen Kuß per Simpatie aus der Kneiphofschen Langgasse in die Magistergasse.[22]
Mit welcher Selbstverständlichkeit und Souveränität sich der pietistische Handwerkersohn sicher in den Kreisen des Adels, der Kaufmannschaft und des Offizierskorps bewegte, hat bei vielen Zeitgenossen immer wieder Erstaunen hervorgerufen. Diese Haltung beruhte offensichtlich auf der schon früh gefestigten Persönlichkeit und der inneren Freiheit eines philosophischen Geistes.
*
Ist diese Umtriebigkeit der Grund dafür, dass Kant in den Jahren kurz vor und während der russischen Besetzung nur drei Veröffentlichungen hervorgebracht hat? Konnte er – „durch einen Strudel gesellschaftlicher Zerstreuungen fortgerissen“ – die Arbeiten, die er im Kopf hatte, überhaupt ausführen, wie Johann Georg Hamann (1730 – 1788), auch einer der ganz Großen der deutschen Geisteswissenschaft, bezweifelte?[23]
Brauchte der junge Kant eine intellektuelle Verschnaufpause?
*
Die beherrschende Philosophie dieser Zeit ging von den Lehren Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 – 1716) und Christian Wolff (1679 – 1754) als den führenden Vertretern der frühen Aufklärung in Deutschland aus. Wolff, von seinen orthodoxen und pietistischen Gegnern – auch innerhalb des preußischen Staates – als Religionsfeind und Determinist bekämpft, hatte unter anderem ein schulbildendes System des Rationalismus entwickelt. Philosophie war für ihn die
„Wissenschaft von allem, was möglich ist, so dass zum Gegenstand der Philosophie alle Dinge gemacht werden müssen, wie immer sie sein mögen, ob sie existieren oder nicht“.
Charakteristisch für seine Lehre war die Ankündigung, er wolle die gesamte Philosophie zu einer „sicheren“ und „nützlichen“ Wissenschaft machen, und zwar durch deutliche Begriffe und gründliche Beweise. Er erneuerte den kosmologischen und ontologischen Gottesbeweis und vertrat eine von der christlichen Offenbarung unabhängige Begründung der Moral. Wolffs Schüler, die so genannten „Wolffianer“, wirkten größtenteils stark popularisierend und hatten im 18. Jahrhundert fast alle philosophischen Lehrstühle in Deutschland besetzt.
Demgegenüber gehörte Christian August Crusius (1715 – 1775), seit 1744 a. o. Professor für Philosophie in Leipzig, in das andere Lager. Er wurde zu einem der einflussreichsten und schärfsten Gegner der leibnizwolffschen Schule. Gegen diese verfocht er eine Einheit der positiven Offenbarung und Vernunft. Er lehnte den ontologischen Gottesbeweis ab.
Kants schon frühe Denkintentionen richteten sich auf eine Verbindung von Metaphysik, Geometrie und Naturwissenschaft. Auch interessierte ihn stark die Geographie, die er später als akademisches Lehrfach mitbegründete.
*
Für das Sommersemester 1758 kündigte Kant ein überwiegend naturphilosophisches Thema an, das er in einer Programmschrift veröffentlichte:
„Neuer Lehrbegriff der Bewegung und Ruhe und der damit verknüpften Folgerung in den ersten Gründen der Naturwissenschaft“[24]
Für Kants naturwissenschaftliches Weltbild waren unter anderem die Annahme der Existenz von Galaxien außerhalb des Milchstraßensystems sowie die Idee von der Hemmung der Erdrotation durch die Flutwelle bedeutsam. Ausgehend von Descartes (1596 – 1650) und Galilei (1564 – 1642) entwickelte Kant die Lehre von der Relativität von Bewegung und Ruhe.
In seiner Schrift Neuer Lehrbegriff…, die gleich beim ersten Erscheinen viel Aufmerksamkeit erregte, dachte Kant über die gegenseitigen Beziehungen zwischen zwei aufeinander stoßende Körper unter den Gesichtspunkten Bewegung, Ruhe, Masse, Geschwindigkeit und Zeit nach. Er nahm als Ausgangsbeispiel eine Kugel, die sich in einem Pregel-Schiff „ruhend “ auf einem Tisch befinde. Das Schiff setze sich langsam „von Morgen gegen Abend“ stromabwärts in Bewegung, während die Erde sich „mit viel größerer Geschwindigkeit von Abend gegen Morgen drehe“.
Kant: „Und nun werde ich schwindlig, ich weiß nicht mehr, ob meine Kugel ruhe oder sich bewege, wohin und mit welcher Geschwindigkeit.“[25]
Kein Körper, gegen den ein anderer sich bewege, könne, so Kant, als in absoluter Ruhe befindlich angesehen werden. In Beziehung auf andere Gegenstände oder Bewegungen könnten Bewegungen, das heißt Ortsveränderungen, nur relativ sein. Daraus leitete Kant – gegen die Auffassung von Leibniz – Stoßgesetze ab und schlussfolgerte, es gäbe keine besondere Trägheitskraft und keinen absoluten Raumbegriff.
Später wird man diese Programmschrift für ein „interessantes Zeichen“ erklären, weil Kant schon hier einige Grundgedanken seines späteren bedeutsamen Werkes Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft (1786) angesprochen habe.[26]
*
Sein eigentliches akademisches Ziel hat Kant nie aus dem Auge verloren. Nach vorherigen Schreiben – zunächst an den Rektor und Senat der Albertina, dann an die philosophische Fakultät – bewarb sich Kant am 14. Dezember 1758 bei der
Allerdurchlauchtigsten Großmächtigsten Kayserin Selbstherrscherin aller Reußen Allergnädigsten Kayserin und Großen Frau
um die vakante Stelle des verstorbenen Johann David Kypke (1692 – 1758), seit 1727 ord. Professor der Logik und Metaphysik . In der kurz gefassten Bewerbung[27] verwies Kant darauf, dass „diese Wissenschaften…jederzeit das vornehmste Augenmerk meiner Studien gewesen“ seien.
Die Schlussformel seiner Bewerbung dürfte dem freisinnigen Magister nicht leicht gefallen sein:
Ich ersterbe in tiefster devotion Ew. Kayserl. Majestät allerunterthänigster Knecht Immanuel Kant“.
Zu dieser Bewerbung soll ihn sein alter Direktor vom Collegium Fridericianum, Franz Albert Schultz (1692 – 1763), ein streng pietistischer Theologe, bewogen und unterstützt haben – nicht ohne sich vorher bei Kant zu erkundigen:
„Fürchten Sie auch Gott von Herzen?“ [28]
Die Bewerbung landete mit weiteren Bewerbungen auf dem Tisch des Generalgouverneurs Korff – die Kaiserin Elisabeth selbst hat sie nie zu Gesicht bekommen.
Im Einvernehmen mit dem Senat der Universität entschied Korff zu
Gunsten von Johann Friedrich Buck (1722 – 1786) – teils aus Ancinietätsgründen, teils aus fachlichen Gründen. Buck, der sich als Ziehsohn des Martin Knutzen bezeichnete, war im Jahre 1758 innerhalb des Lehrkörpers der Königsberger Universität und darüber hinaus als akademischer Lehrer zweifelsohne mit größerer wissenschaftlicher Reputation ausgestattet als der wesentliche jüngere aufstrebende Magister Kant.
Und was macht Kant?
Das beschreibt sein früherer Student und erster „offizieller“ Biograph Ludwig Ernst Borowski (1740 – 1832):
„Kant, der den Schickungen gern ihren Gang ließ; der so wenig Mäzenaten suchte, dass ihm nicht einmal der Name des damaligen Oberkurators der preußischen Universitäten bekannt war; der nach Berlin hin weder korrespondierte, noch seine Schriften seinen etwaigen Gönnern dedizierte, kurz, der jeden Schleichweg seiner unwürdig fand, auf dem er einen anderen hätte verdrängen können, blieb ganz ruhig in seiner Lage und wirkte durch Vorlesungen und Schriften weiter fort.“[29]
*
Es war im Sommer 1759, als Kant mit dem sechs Jahre jüngeren Hamann wieder enger in Kontakt trat. Die beiden Männer waren sich schon früher in der physisch (physico) – theologischen Gesellschaft begegnet – in einer Gesellschaft , die 1748 (oder früher?) von Martin Knutzen zusammen mit Johann Christoph Berens (1729 – 1792), dem Sohn eines Rigaer Kaufmannshauses, sowie Johann Gotthelf Lindner und anderen gegründet worden war.
Berens, der Studienfreund und späterer Gönner Hamanns, wollte nun mit Hilfe von Kant den seiner Ansicht nach durch religiöse Schwärmerei („Bekehrung zu Christo“) und Aberglauben fehlgeleiteten Hamann für die Ideale von Weltbürgertum und Aufklärung zurück gewinnen. Die Bemühungen der beiden verliefen indes ohne Ergebnis. Kant hatte in diesem Zusammenhang auch versucht, Hamann zu bewegen, Artikel aus der berühmten Encyclopédie des französischen Schriftstellers Denis Diderot (1713 – 1784) zu übersetzen, um so auf freiere Gedanken zu kommen – vergeblich!
In ähnliche Richtung dürfte ein weiteres Bemühen Kants um Hamann am Ende des Jahres 1759 gegangen sein: der Vorschlag, gemeinsam mit ihm, Hamann, eine Physik für Kinder zu schreiben. Die tatsächlichen Gründe, die Kant zu dieser Überlegung bewegten, sind nicht bekannt.
Wollte er, der Autor der bedeutenden und viel beachteten Allgemeinen Naturgeschichte und der Theorie des Himmels (1755), mit einem naturkundlichen Schulbuch für die Jugend auf der Grundlage aufgeklärter Pädagogik verstärkt die Kenntnisse der „Realien“ vermitteln? Geschah die Bitte an Hamann um Mitarbeit auch in der Befürchtung Kants, in Sachen praktischer Pädagogik und Didaktik eines Beistandes zu bedürfen?
Die einzigen Quellen zum Thema Kinderphysik sind drei Briefe Hamanns an Kant vom November (?) 1759 und eine Beilage.[30] In ihnen greift Hamann seinen Freund und Gegenspieler Kant in polemisch-ironischer und fast verletzender Weise an. Er bezweifelt unverblümt, dass Kant, dem die Studenten in seinen Vorlesungen schon kaum folgen könnten, sich in die Seele von Kindern versetzen und sich zu ihren Schwächen herablassen könne. Es gehöre nun einmal zu einem solchen Vorhaben
„…eine vorzügliche Kenntnis der Kinderwelt, die sich weder in der galanten noch in der akademischen erwerben lässt“.
Kant möge sich prüfen, so Hamann, ob er das Herz habe, der Verfasser einer einfältigen, törichten und abgeschmackten Naturlehre zu ein. Polemisch ermuntert er ihn mit den Worten Horaz: Vale et sapere aude (Lebe wohl und wage es, weise zu sein).
Hamanns Ausführungen zu Inhalten und Grundlage einer Kinderphysik gingen über die pädagogisch-didaktischen Reflexionen hinaus: er empfahl Kant,
„…auf dem hölzernen Pferde der mosaischen Geschichte zu reiten, und nach den
Begriffen, die jedes Christenkind von dem Anfang der Natur hat,…“[31]
die Physik vorzutragen. Zu den Unterrichtsgegenständen machte er konkrete Vorschläge (Licht, Feuer, Lufterscheinungen, Wasser, Sonne Mond, Sterne, Tiere und „vom Menschen und der Gesellschaft“).
Hamann kam es letztlich darauf an, den biblischen Schöpfungsbericht der Genesis zur Grundlage des Unterrichts zu machen.
Dies aber musste in unversöhnlichem Gegensatz zu der Absicht Kants – dem akademischen Lehrer in Geographie und mathematischer Physik – gestanden haben: nämlich der Jugend im Dienste der Aufklärung die Welt und die fundamentalen Grundlagen der Naturwissenschaften nach Newtonschen Prinzipien rein mechanistisch zu erklären.
Zu einer Kinderphysik ist es daher nie gekommen.
Kant, dem ohnehin eine ernste Abneigung zum Briefschreiben nachgesagt wurde, hat zu Hamanns Briefen nicht Stellung genommen – was Hamann als „Beleidigung„ empfand.
*
Mit seiner zweiten Schrift – dem Versuch einiger Betrachtungen über den Optimismus[32] – kündigte Kant seine Vorlesungen für das Wintersemester 1759/60 an.
Ideengeber für diese Vorlesung dürfte eine von der Berliner Akademie der Wissenschaften schon für 1755 gestellte philosophische Preisaufgabe gewesen sein („Untersuchung des Systems von Alexander Pope [1688 – 1744], das in der Behauptung Tout est bien enthalten ist“).
Inhaltlich bekämpfte Kant in dieser Schrift die Annahme, Gottes „unbedingtes Belieben“ könne das Schlechtere dem Besseren vorziehen. Er verteidigt seine Auffassung, dass Gott, wenn er wähle, nur das Beste wähle. Wenn Gott also
„…diese Welt unter allen möglichen, die er kannte, allein wählte, muss er sie für die beste gehalten haben, und weil sein Urteil niemals fehlt, so ist sie es auch in Tat.“
Kant versuchte mithin zu beweisen, dass es tatsächlich eine mögliche Welt gebe, über die hinaus sich keine bessere Welt denken ließe. Er attackierte im Wesentlichen die Position, die Crusius gegen Leibniz vertrat.
Die Optimismus-Schrift löste einen fachlichen Auffassungsstreit zwischen Kant und seinem Universitäts-Kollegen und -rivalen Daniel Weymann (1732-1795) aus, der in meist polemisierender Form über Jahre andauerte. Weymann war mit anderen an der Universität ein leidenschaftlicher Verfechter der Crusius´schen Lehre. Er hatte auch eine bemerkenswert große Anzahl von eifrigen Studenten. Unter ihnen war jener 21jährige russische Leutnant Andrey Bolotov (1738 – 1833), der als Schreiber und Übersetzer in der Kanzlei des Gouverneurs arbeitete. Bolotov ließ sich – nach eigenen didaktischen Studien der Wolff´schen Philosophie – von dem Pietisten Weymann zur „neuen und so viel besseren und vorzüglichen “ Philosophie eines Crusius führen, weil
„…sie jeden in ihr sich nähernden Menschen, selbst wenn er es nicht wolle, fast unwillkürlich in einen guten Christen verwandelt, während die Wollf´sche Philosophie, umgekehrt, auch einen guten Christen fast immer in einenschlechten verwandelt, wenn nicht gar in einen Deisten und Kleingläubigen,..“[33]
Das mag der Grund dafür sein, dass Bolotov in seinen Aufzeichnungen über sein Leben in Königsberg den Dozenten Kant überhaupt nicht erwähnt. Die von Weymann für seine Zulassung als magister geschriebene Dissertatio Philosophica de mundo non optimo wurde von Kant geringschätzig als eine „ziemlich unordentlich und unverständliche dissertation wieder den Optimismus“ bezeichnet. Kant hatte keine Neigung, sich mit einem „Cyclopen“ auf Faustschläge einzulassen und zog es vor, „auf die anständigste Art, das ist durch Schweigen, zu antworten“.[34]
*
Eine weitere Veröffentlichung ist ein Brief, den Kant am 6. Juni 1760 an die trauernde Mutter seines Studenten Johann Friedrich von Funk (1738 – 1760) schrieb[35], der mit 21 Jahren an Schwindsucht verstorben war:
In ihm würdigte Kant als ein – wie er sich selbst bezeichnete – „Lehrer der Weltweisheit auf der Akademie zu Königsberg“ nicht nur in anrührender Weise den Verstorbenen. Er machte sich auch allgemeine Gedanken über den Sinn des Lebens:
Die eigenen Pläne, die Fähigkeiten, das eheliche Glück, die Vergnügungen und Unternehmungen seien, so Kant, Träumereien. Doch unser wahres Schicksal führe uns ganz andere Wege. Das Los, das uns wirklich zu Teil werde, sähe demjenigen selten ähnlich, was wir uns versprochen hätten. Wir fänden uns bei jedem Schritte, den wir tun, in unseren Erwartungen getäuscht. Indessen verfolge die Einbildung ihr Geschäft weiter und ermüde nicht, neue Entwürfe zu zeichnen, bis dass der Tod, der noch immer fern zu sein scheine, plötzlich dem ganzen Spiele ein Ende bereite. Was schon die Römer ausgerufen hätten, entspräche auch unserer allgemeinen Empfindung:
„Ich bin ein Mensch, und was Menschen widerfährt, kann auch mich treffen“.[36]
*
Königsberg wieder preußisch
Am 5. Januar 1762 verstarb Kaiserin Elisabeth – „Das ist der erste Sonnenstrahl, der uns leuchtet“ schrieb Friedrich II zu diesem Mirakel des Hauses Brandenburgs einige Wochen später.[37] Und:
“Seitdem der Tod ein gewisses liederliches Weibsbild eingescharrt hat, ist unsere Lage weitaus erträglicher geworden, als sie es bisher war!“[38]
Der Neffe Elisabeths – unter dem Namen Peter III (1728 – 1762) – bestieg den Thron, was man in Ostpreußen mit zuversichtlichen Erwartungen begrüßte. Friedrich II ließ umgehend etliche russische Kriegsgefangene frei. Durch den neuen Königsberger Gouverneur v. Panin (1718 – 1783), einem Manne von offener preußenfeindlicher Gesinnung, wurde eine Landestrauer mit dem täglichen Geläut aller Glocken angeordnet.
Am 16. März vereinbarte Friedrich II mit Zar Peter, seinem glühenden Bewunderer, „dem üppigen preußischen Fähnrich“ (v. Hippel), einen Waffenstillstand in Stargard. Am 5. Mai folgte der Friedensvertrag von St. Petersburg. Die Proklamation des Friedens fand in Königsberg am 5. Juli unter großer begeisternder Teilnahme der Bevölkerung statt. Die Zeitungen erschienen wieder in der früheren Aufmachung, insbesondere die „Königlich privilegirte Preußische Staats-, Kriegs- und Friedenszeitungen“ mit dem einköpfigen preußischen Adler. Die russischen Wachen an den Stadttoren wurden durch die reorganisierte Königsberger Bürgerwehr ersetzt. Am Rathaus, am Münzgebäude und am Posthaus wurden die bekränzten Adler wieder angebracht. Am 9. Juli kehrten die Provinzialregierung und die Vertreter des Etatsministeriums nach Königsberg zurück. Es folgten zahlreiche Festveranstaltungen, Kanonen wurden abgefeuert, in Pillau die Schiffe preußisch beflaggt. In den Straßen wogte eine jubelnde Menge. Auch die Universität hatte in lateinischer Sprache zu einen feierlichen actus publicus eingeladen und ein Festgedicht vortragen lassen. In der Schlosskirche und im Dom fanden Gottesdienste statt. Illuminationen folgten im bunten Wechsel.
Wenige Tage zuvor hatte allerdings im fernen St. Petersburg Katharina (1729 – 1796), die Frau von Peter III, mit Hilfe ihres Liebhabers, Graf Grigori G. Orlow (1734 – 1783), eine Verschwörung angezettelt und den Sturz des ungeliebten Zaren erreicht. Er wurde eingekerkert und am 7. Juli 1762 erwürgt. Als Katharina II bestieg die Witwe den Kaiserthron. Der von Peter III geschlossene Frieden von St. Petersburg wurde darauf annulliert, die Provinz Preußen erneut unter die russische Hoheit gestellt. Die preußischen Staatsinsignien verschwanden wieder von den öffentlichen Gebäuden. Die Königsberger Zeitung wurde abermals offizielles kaiserlich-russisches Presseorgan mit dem Doppelaar auf der ersten Seite. Die russischen Truppen besetzten erneut die Festung Friedrichsburg.
Kurzum: es wurde alles wieder so wie zu Kaiserin Elisabeths Zeiten.
Doch dann – aus mehreren Gründen – verzichtete Katharina II endgültig darauf, das eroberte Ostpreußen auf Dauer in Besitz zu nehmen. Der mit Friedrich II geschlossene Friedensvertrag wurde einfach bestätigt. Die Bevölkerung wurde wiederum durch eine Proklamation des jetzigen Gouverneurs Feodor v. Woyeikow am 6. August 1762 in Kenntnis gesetzt, dass das Königreich Preußen nunmehr zur freien Disposition Friedrich II gestellt werde, und die Untertanen zur Treue gegenüber dem angestammten Landesherrn ermahnt.
Dies war die letzte Amtshandlung eines russischen Gouverneurs in Ostpreußen.
Noch am selben Tage hielt der von Berlin kommende greise Feldmarschall v. Lehwaldt unter großem Jubel der Bevölkerung seinen Einzug in Königsberg „…unter dem Vorritte einer Menge blasender Postillione“. Die äußeren Zeichen der russischen Herrschaft wurden beseitigt. Nur der Abmarsch der kaiserlich-russischen Truppen verzögerte sich über Gebühr – wohl aus Mangel an Transportmitteln. Die totale Räumung der Provinz wurde daher erst Mitte September 1762 vollzogen.[39]
Und was macht Kant?
*
Kant bereitete sich auf das Wintersemester 1762 vor und verfasste eine kleinere Abhandlung als Ankündigung seiner Vorlesungen über Logik mit dem TitelDie falsche Spitzfindigkeit der vier syllogistischen Figuren[40]
Hier führt Kant den Leser in die allgemeine Natur eines „Vernunftschlusses“ (Syllogismus) ein und erläutert die obersten Regeln aller Vernunftschlüsse.
Mit der auf Aristoteles zurück gehende Theorie der „Syllogistik“ (Lehre von den vier Figuren der logischen Schlüsse), diesem „unnützen Plunder“[41], rechnet er scharf ab. Die Schullogik erschien ihm ungeeignet, soweit sie meine, allein aus Begriffen, Urteilen und Schlüssen Erkenntnisse schöpfen zu können.
„In der Tat, wo jemals auf eine gänzlich unnütze Sache viel Scharfsinnigkeit verwandt und viel scheinbare Gelehrsamkeit verschwendet worden ist, so ist es diese.“
Kant glaubte dennoch nicht – insoweit ganz wirklichkeitsnah -, mit einer „Arbeit von einigen Stunden“ die auf tönernen Füßen stehenden Denkgebäude seiner Zeit („Kolosse“) zum Einsturz zu bringen. Immerhin seien die Spitzfindigkeiten der Syllogistik – wie er ironisch bemerkte – insoweit brauchbar,
„in einen gelehrten Wortwechsel dem Unbehutsamen den Rang abzulaufen…eine Kunst, die sonst wohl sehr nützlich sein mag, nur dass sie nicht viel zum Vorteil der Wahrheit beiträgt“.[42]
*
Es mag erstaunen, dass in Kants Schriften und Briefen zur Zeit der russischen Besetzung von den politischen und kriegerischen Auseinandersetzungen nirgendwo die Rede ist. Der Mann, der sich für das Tagesgeschehen interessierte und begierig auch die erhältlichen Königsberger Zeitungen las, beklagte nur an einer Stelle (1760), dass
„Zu einer Zeit, da ein wütender Krieg die Riegel des schwarzen Abgrundes eröffnet, um alle Trübsale über das menschliche Geschlecht hervorbrechen zu lassen, da sieht man wohl, wie der gewohnte Anblick der Not und des Todes denen, die selbst mit beiden bedroht werden, eine kaltsinnige Gleichgültigkeit einflößt, dass sie auf das Schicksal ihrer Brüder wenig acht haben.“[43]
*
Noch während die letzten russischen Truppen Ostpreußen verlassen, erhält Kant endlich im Hochsommer 1762 von seinem späteren Vermieter und Verleger, dem umtriebigen Buchhändler Johann Jakob Kanter (1738 – 1786), die beiden Schriften, um die er sich nach deren Erscheinen schon wochenlang bemüht hatte:
Den Du contract social ou Principes du droit politique und den Bildungsroman Émile ou de l’éducation des französisch-sprachigen Philosophen und Pädagogen Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778).
Beide Werke hatten in Frankreich scharfe Verurteilungen ausgelöst. Neben den französischen Autoritäten waren insbesondere die calvinistischen Oberen in Genf leidenschaftlich entrüstet. In Paris und Genf waren Exemplare der Schriften auf dem Scheiterhaufen gelandet!
Der Émile wurde schließlich ebenso wie der Contract social verboten, gegen den Autor Rousseau Haftbefehl erlassen!
…und was wird Kant machen?
[1] Norbert Weis, Königsberg. Immanuel Kant und seine Stadt. Braunschweig 1993, S. 24
[2] Xaver v. Hasenkamp, Ostpreußen unter dem Doppelaar, Königsberg, Theile´sche Buchh., 1866, S. 267
[3] Johann Georg Bock (1698 – 1762), Bericht über die russische Besatzungszeit, 1758, in Bernd Dörflinger u.a., Königsberg 1724 – 1804, Hildesheim: Olms, 2009, S. 213
[4] Karl Vorländer, Immanuel Kants Leben, neu hrg. von Rudolf Malter, 4. A., Hamburg: Meiner, 1986, S. 30
[5] Bernd Dörflinger u.a., a.a.O., S. 209 – 211 (Text139)
[6] Kurt Stavenhagen, Kant und Königsberg, Göttingen, Deuerlich, 1949, S. 17
[7] Ebd. S. 21
[8] Johann George Scheffner, Mein Leben, wie ich es selbst beschrieben, Leipzig, Neubert, 1816/1823, S. 67
[9] v. Hasenkamp, a.a.O., S. 353ff
[10] v. Hasenkamp, a.a.O., S. 358
[11] Johann George Scheffner, a.a.O., S. 67
[12] Götz v. Selle, Geschichte der Albertus-Universität zu Königsberg in Preussen, 2.A., Würzburg, Holzner, 1956, S. 157
[13] Kant an Lindner am 28.10.1759 in Otto Schöndörffer, Immanuel Kant, Briefwechsel, Erster Band, Leipzig, Meiner, 1924, S. 17
[14] Karl Vorländer, Immanuel Kant, 3. A., Hamburg, Meiner, 1992, S. 81
[15] v. Hasenkamp, a.a.O., S. 353
[16] Werner Stark, Wo lehrte Kant? in Joseph Kohnen (Hg.), Königsberg: Beiträge zu einem besonderen Kapitel der deutschen Geistesgeschichte des 18. Jhd., Frankfurt/M., Lang, 1994, S. 90
[17] Reinhold Bernhard Jachmann in Rudolf Malter, Immanuel Kant in Rede und Gespräch, Hamburg, Meiner, 1990, S. 7
[18] Die Quelle für diese Bezeichnung ist bisher unbekannt!
[19] Otto Schöndörffer, Der elegante Magister, in Reichls Philosophischer Almanach 1924, Darmstadt, Reichl, 1924, S. 71
[20] Ludwig Ernst Borowski in Rudolf Malter, a.a.O., S.
[21] Jachmann, in Rudolf Malter, a.a.O., S. 5
[22] M.C. Jacobi im Brief vom 12.06.1762 an Kant in Otto Schöndörffer, Immanuel Kant, Briefwechsel, a.a.O., S. 31
[23] Hamann an Lindner am 1.2.1764 in Rudolf Malter, Immanuel Kant in Rede und Gespräch, a.a.O., S.74 f
[24] in Kants Werke, Akademie-Textausgabe, Bd. II, Berlin, Walter de Gruyter & Co., 1968, S. 13ff
[25] Ebd. S. 17
[26] Karl Vorländer, Immanuel Kants Leben, neu hrg. v. Rudolf Malter, a.a.O., S. 50
[27] in Otto Schöndörffer, Immanuel Kant, Briefwechsel, a.a.O., S. 5f
[28] Felix Gross, Immanuel Kant – Sein Leben in Darstellungen von Zeitgenossen, Darmstadt, Wiss.
[29] Buchges., 1993, S. 16, Felix Gross, a.a.O., S. 16f
[30] in Otto Schöndörffer, Immanuel Kant, Briefwechsel, a.a.O., S. 18 ff.
[31] Ebd., S. 22
[32] in Kants Werke, Akademie-Textausgabe, Bd. II, a.a.O., S. 27ff
[33] Andrej Bolotov, Leben und Abenteuer des Andrej Bolotov von ihm selbst für seine Nachkommen aufgeschrieben, Erster Band, München, Beck, 1990, S. 357
[34] Kant an Lindner am 28.10.1759 in Otto Schöndörffer, Immanuel Kant Briefwechsel, a.a.O., 16ff
[35] in Kants Werke, Akademie-Textausgabe, Bd.II, a.a.O., 37ff
[36] Ebd., S. 40
[37] v. Hasenkamp, a.a.O., S. 385
[38] Ebd., S. 387
[39] v. Hasenkamp, a.a.O., S. 399
[40] s. Kants Werke, Akademie-Textausgabe, a.a.O., S. 45ff
[41] Ebd., S. 57
[42] Ebd., S. 57
[43] In den Gedanken bei dem frühzeitigen Ableben des …von Funk, Kants Werke, Akademie-Ausgabe, a.a.O., S. 40