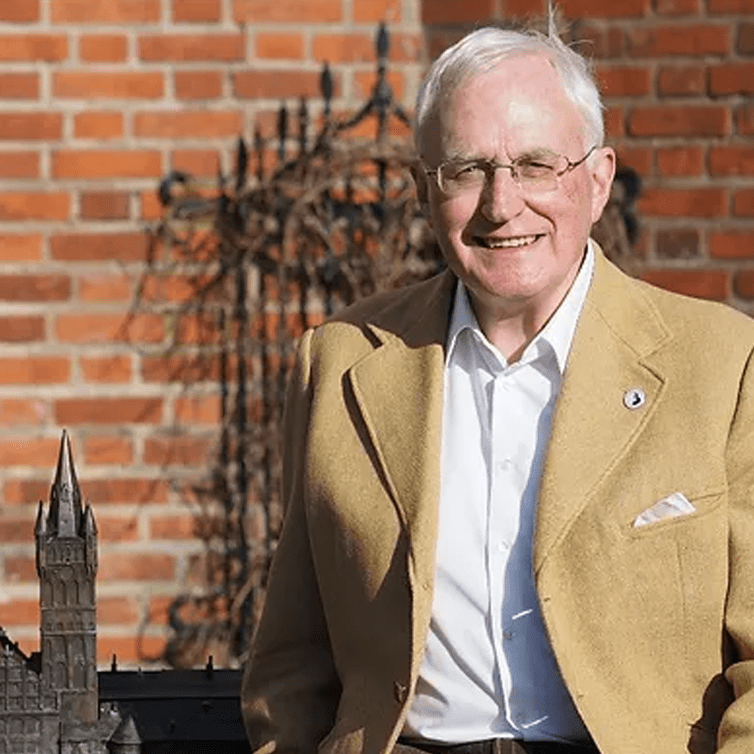1. Aufklärung und Gegenwart
In der Aufklärungsepoche war Königsberg die Stadt, die dank Kant sich zu einer besonderen Mission zu erheben suchte oder durch den aufgeklärten Willen berufen wurde, sich zu der Mission erheben zu lassen und zwar zu der der Hauptstadt nicht nur der „reinen Vernunft“, sondern auch des „ewigen Friedens“. Es hat sich aber gefügt, dass im Gegensatz zu dieser Berufung Königsberg zu einem ganz anderen Sinnbild, zu einem einzigartigen Zeichen der Weltgeschichte wurde und zwar zu einem vielsagenden „Emblem der Apokalypse“ (so Klaus Garber in seinem Vorwort zur „Kulturgeschichte Ostpreußens in der Frühen Neuzeit“), zu einem Emblem der anhaltenden Welttragik, in der sich ein selbstdestruktives Unvermögen, sei es hermeneutisch oder pragmatisch, erahnen lässt. In seiner historischen Dramaturgie wäre Königsberg ein schmerzvoller Anlass zum Ende des „Konflikts der Interpretationen“ und zu einem objektiveren Verständnismodell über die zwei zu einander entgegengesetzten eschatologischen Perspektiven der Weltgeschichte:
1) einerseits, die apokalyptische Perspektive „des Willens zum Tode“, sei die durch den Verlust der theozentrischen Subjektivität in der Ontodynamik oder durch den Verrat des „moralischen Gesetzes“ verursacht;
2) anderseits, die soteriologische Perspektive des „Willens zum Leben“, d.h. zu einer neuen Qualität des Daseins, der „synergetischen Ontodynamik“, sei es die des ontologischen Dialogs zwischen Gott und Mensch oder die der Praxis des Willens des „moralischen Gesetzes“.
Neben Kant ist einer der bekanntesten Söhne dieses nicht mehr existenten Königsberg J.G.Hamann, nach dem Wort Goethes im Gespräch mit Kanzler Friedrich von Müller von 1823 „der hellste Kopf seiner Zeit“. Dieser Hamann, der sich mit alttestamentischer prophetischer Wucht auf die angesehenen Vertreter der europäischen Aufklärung stürzte, den König der Philosophen Friedrich II., seinen Königsberger Freund Kant und seinen Schüler Herder eingeschlossen, hatte aber eine besondere Achtung vor Lessing, als einem „Mann, der selbst gedacht [hatte], und dem es ein Ernst gewesen [war] eine neue Bahn zu brechen“ (so Hamann im Brief an Herder vom 28. März 1785. Hamann wusste etwas zu schätzen, was ihn mit Kant eint und was bestimmt das innigste Wesen nicht nur des Phänomens Lessing ausmacht, sondern des gesamten Zeitalters der Aufklärung, und zwar „seinen lebendigen Drang nach Wahrheit“, so Hamann im Brief an Herder vom 9. Dezember 1781, wo er dem schon verstorbenen Lessing seine „volle Unterstützung“ ausdrückt. „Der lebendige Drang nach Wahrheit“ ist wohl das allerwichtigste Gebot der Aufklärung für die heutige Welt. Ob sie aber „eine neue, von ihr angestrebte Bahn“ gebrochen hat, ob sie vollendet ist?
„Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen.“ So, wie allgemein bekannt, das Wesen der Aufklärung in der Formulierung von Kant. Aufklärung ist also ein paradigmatischer Exodus, ein kontrastvoller Auszug aus heteronomen religiösen, kulturellen und gesellschaftlichen Zusammenhängen, in denen das Andere, also die Anderen, uns Menschen das Gesetz vorschreiben, statt dass wir uns Menschen selbst dieses Gesetz (‚nomos’) vorhalten. Also ist die Aufklärung der Auszug aus der Hetero-nomie in die Auto-nomie, wo aber die Gefahr der A-nomie sich dramatisch zuspitzt. Der von Emil Durkheim geprägte Begriff der A-nomie gilt für einen sozialen Zustand, in dem die Verhaltensnormen einer Gesellschaft nicht mehr eindeutig erkennbar sind, d.h. wo die grundlegenden Voraussetzungen für eine um lebenswichtige Werte integrierte Intersubjektivität gestört sind. Ohne die Intersubjektivität gehen nicht nur gesellschaftliche Gebilde, gesamte Kulturen und Zivilisation unter, wie die Geschichte zeigt, sondern die Anomie kann letztendlich das planetarische Chaos verursachen, was wohl auch Christus in seiner warnenden Weissagung im Matthäus 24, 12 meint: „Weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der vielen erkalten…“
Ob die moderne, oder postmoderne, Zivilisation aus „seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit“ ausgegangen ist? Ob das moderne Denken nach wie vor als „Gespräch über Auswege“ (so ein scharfsinniger Kantinterpret Odo Marquard), d.h. aus schwierigen Situationen verstanden werden kann? Ob wir imstande sind, diejenige Intersubjektivität aufzuarbeiten, die uns von der Anomie nach dem Übergang von der Heteronomie in die Autonomie erlösen kann? Oder sollen wir die hermeneutische Skepsis der postmodernen, eher enthofften, Denker teilen? Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? –
Man will nicht auf den aufklärerischen Anspruch, die weltbekannten Fragen Kants zu beantworten, verzichten. Gerade vor diesem Hintergrund ist das hermeneutisch korrekte, gleichfalls kritisch ausgerichtete Verstehen der bekannten Hoffnungsprojekte der Vergangenheit und der Ursachen für deren Scheitern so wichtig. Das gilt auch für Kant, dessen Gnoseologie der reinen Vernunft mit der Grundidee der subjektzentrischen Autonomie die Denkgeschichte der Menschheit verändert hat, dessen Praxiologie der praktischen Vernunft aber bis heute nicht praktiziert wird, obwohl gerade diese das Hauptanliegen seiner kritischen Philosophie war. Wie oben erwähnt wäre Königsberg schon einmal fast zur Hauptstadt einer hohen Mission im Sinne der Aufklärungsideale geworden. Aber nur fast. Das „Fast“ ist aber gefährlich, was auch Kant in seinem Werk, z.B. in der Schrift „Zum ewigen Frieden“ deutlich artikuliert hat, als ob er in der Logik der strengen Rationalität uns die bekannte Warnung Christi im Bergpredigt nahlegen wollte: „Es sei euer Wort Ja ein Ja, Nein ein Nein. Was darüber geht ist vom Bösen.“ (Mat. 5, 37) Kants „kopernikanische Wende“ oder Lessings Projekt zur „Erziehung des Menschengeschlechts“ oder Moses Mendelssohns „Toleranzphilosophie“ – das alles ist letztendlich ganz eschatologisch geprägt und duldet keine „Jains“. Diese Wende der Aufklärung ist die Einsicht in den absoluten Verlust des objektiven Realitätsprinzips und die Entdeckung einer neuen subjektzentrischen Ontologie, die aber voll und ganz auf den Menschen angewiesen ist. Denn das Überleben dieser Ontologie hängt von der Frage ab, ob die Freiheit möglich ist? Ob der Mensch als mit Vernunft behaftetes Wesen die freie Kausalität des moralischen Gesetzes realisieren wird? Wenn ja, dann führt der Weg zum „allgemeinen Besten“ (so Lessing), zur Verwirklichung eines „allgemein menschlichen Rechts auf Glückseligkeit“ (so Mendelssohn), zu einem „allgemein das Recht verwaltenden Völkerbund und zum ewigen Frieden“ (so Kant); wenn nicht, dann „zum ewigen Frieden auf dem Kirchhof der Menschengattung“…
2. Kant und Lessing
Bei Lessing, der aus der vorkritischen Zeit der Aufklärungsepoche stammt, ist der „ontologische Bruch“ mit all seinen dramatischen und verpflichtenden Folgen noch nicht so äußerst zugespitzt wie bei Kant, denn Lessing rechnet mit dem Vermögen der menschlichen Empfindsamkeit, in der er, wohl unbewusst für sich, unter den Verhältnissen der eingesetzten Autonomie so eine Art heteronome Ausrichtung der für seine Katharsistheorie bestimmenden Existentiale „Mitleid“ und „Furcht“ zu erfahren vermag. Die „vertikal“ disponierten psychologischen Zustände erweisen sich die Lessingschen Brücken, Fähren zur Natur, wo er die Wahrheit ersucht. Dadurch ist seine Theorie des Realismus in der „Hamburgischen Dramaturgie“ bedingt, die sich deutlich von der Kantischen unterscheidet: Durch eine gleichberechtigte Teilnahme des dem „poesis“ unterworfenen Objekts und des ästhetischen Subjekts, d. h. der abzubilden Natur und des Künstlers, entstehe eine „getreue“ Nachahmung der Natur. In seiner Kritik der ästhetischen Schulweisheit des 18. Jahrhunderts über die „Nachahmung der Natur“ und „Verschönerung der Natur“ kommt Lessing im 70. Stück der Dramaturgie zu dem für seine Theorie entscheidenden Schluss, dass eine getreue Abspiegelung auch der „gemeinsten und alltäglichsten“ Natur nur eine Hälfte der Natur wiedergebe: „sie ahmet der Natur der Erscheinungen nach, ohne im geringsten auf die Natur unserer Empfindungen und Seelenkräfte dabei zu achten.“1 Und diese Empfindungen und Seelenkräfte sind nach Lessing das Vermögen, aus der Flucht der Erscheinungen jene Zusammenhänge der Wirklichkeit herauszuheben, in denen sich das Nichtige vom Wichtigen scheidet. „In der Natur“, so formuliert Lessing, indem er unter „Natur“ immer die ganze natürliche und gesellschaftliche Wirklichkeit des Menschen versteht, „ist alles mit allem verbunden; alles durchkreuzt sich, alles wechselt mit allem, alles verändert sich eines in das andere.“(S.342) Die Menschen wären hilflos solcher unendlichen Mannigfaltigkeit preisgegeben, wenn sie nicht jenes Vermögen hätten, „abzusondern und ihre Aufmerksamkeit nach Gutdünken lenken zu können.“ (Dieses unpersönliche „Dünken“ erscheint mir ganz wichtig für das richtige Verständnis Lessings, denn es deutet den Hinweis auf die heterogene Eigenart der ästhetischen Absonderung an.) Was wir in der realen Welt von einem Gegenstand oder einer Verbindung verschiedener Gegenstände „absondern oder absondern zu können wünschen“, sondert die Kunst wirklich ab. Sie gewährt uns die Gegenstände der Wirklichkeit und ihre wesentlichen Zusammenhänge „so lauter und bündig, als es nur immer die Empfindung, die sie erregen sollen, verstattet.“(S. 342) D.h. Lessing erkennt schon die teilnehmende Rolle der wesentlichsten Hälfte des menschlichen ästhetischen Vermögens an der dialektischen Hervorbringung („poesis“ – Hervorbringung) der Wirklichkeit. Durch die Absonderung und Verknüpfung eben dieser wesentlichen Wirklichkeit ist die Kunst das „Reich des Schönen“, nicht aber im Sinne der „Verschönerung“ der Natur, sondern im Sinne jener großen realistischen Verhältnisse, worin die Beziehungen der Menschen zur „Natur“, zu ihrer Welt „lauter und bündig“ sich ausdrücken. Diese Beziehungen finden ihr Maß in der Empfindung, die das Kunstwerk erregen soll, und diese Empfindung bedeutet zugleich das humanistische Maß, nach welchem im Kunstwerk eine Wirklichkeit entsteht, deren dem Menschen wichtige Züge nicht durch „andere von nichtigem Belange“ verdeckt und verhäßlicht werden (so Lessing im 70. Stück).
Dadurch ist es zu erklären, dass Lessing sich gern an das Urteil des Aristoteles in der „Poetik“ schließt: die Poesie sei philosophischer und nützlicher als die Geschichte, denn des Dichters Werk, sagt Aristoteles in Lessings Übersetzung im 89. Stück, ist nicht „zu erzählen, was geschehen, sondern zu erzählen, von welcher Beschaffenheit das Geschehene, und was nach der Wahrscheinlichkeit oder Notwendigkeit dabei möglich gewesen… Denn die Poesie geht mehr auf das Allgemeine, und die Geschichte auf das Besondere…“ (S. 428)
Ohne weitere Vertiefung in die Lessingsche Kunsttheorie seien wohl zwei Aspekte hervorgehoben: erstens, die deutliche Verknüpfung des Aristotelisch-Lessingschen Verständnisses des Begriffs „Allgemeinheit“ mit der in der „Hamburgischen Dramaturgie“ angestrebten Intersubjektivität der empfindsamen und moralischen Nation; zweitens, Lessings „ästhetische Hoffnung“ auf das sinnliche Vermögen der Menschen, im „Reich des Schönen“ durch die immerwährende ungebrochene Einheit der Natur und Wahrheit sich reinigen zu lassen. Lessing wie viele bis heute vertraut der Wahrheit der empfindsamen Natur in uns und hofft dadurch am Anfang der „Hamburgischen Dramaturgie“ auf das freie bürgerliche Gefühlsvermögen der moralischen aufgeklärten Ontologie. Kant aber, dieser Cherubim der Aufklärung mit der flammenden Schwertklinge, zieht eine wichtige warnende Grenze für Lessings Wahrheitsbegriff und Hoffnung: Ästhetische Erziehung schafft einen ausbalancierten Zustand zwischen dem „freien Spiel der Erkenntnisvermögen“ in der ästhetischen Wahrnehmung (so Kant in der „Kritik der Urteilkraft“) und dem moralischen Ethos nur unter der Bedingung der Dominanz der Sittlichkeit über der Natur in uns. Diese grundlegende Erkenntnis gipfelt im §59 der „Kritik der Urteilskraft“ unter dem Namen „Von der Schönheit als Symbol der Sittlichkeit“.
Kant und Lessing unterscheiden sich wie „Sollen“ und „Sein“: Lessings Gegenwart der Wahrheit im sittlichen Wesen, was demnächst Schiller unter „schöner Seele“ im Briefwechsel mit Goethe oder einem „Kind des Hauses“ in der Schrift „Über Anmut und Würde“ versteht, – dieser „Sein-Modus“ mit der Neigung zur Tugend im „freien Spiel“ der Gefühle sei nach Kant nur „ein Kennzeichen einer guten Seele“, das „wenigstens eine dem moralischen Gefühl günstige Gemütsstimmung“ anzeigt. Entscheidend ist jedoch das Sollen, das quer zu allem steht, was auch in der Natur ist, oft quer zum Spiel unserer Neigungen und Wünsche. Im Gegensatz zu Schillers „Weil es die Schönheit ist, durch welche man zu der Freiheit kommt“ in seinem Projekt „Über die ästhetische Erziehung des Menschen“ wäre die Kantische Idee wie folgt formulierbar: „Weil es die Freiheit ist, durch welche man zu der Schönheit wandert“, denn gerade der Kantische Begriff der Freiheit ist letztendlich die Grundlage der Aufklärungshoffnung insgesamt, denn alle Wege sowohl des Kantischen geschichtsphilosophischen, als auch des gesamten Aufklärungsprojekts führen auf die Frage zurück, ob die Freiheit, wie sie Kant versteht, möglich ist.
Eigentlich hat sich die Richtigkeit der zugespitzten Fragestellung über die Möglichkeit der Freiheit schon längst bewährt, was auch die Postmoderne beweist. Die Dramatik des Weltprojekts der Aufklärung ist aber die, dass sie in der Tat die Welt verändert, indem sie zur paradigmatischen Grundlage der technomorphen Zivilisation wurde, aber nur „fast“ verändert, nur in Richtung anmaßende „reine Vernunft“, obwohl das Hauptanliegen des Weltszenariums der Aufklärung die „praktische Vernunft“ war. Im 20. Jahrhundert ist der verzweifelte Kampf gegen das „Fast“ der Aufklärung leicht erkennbar, symbolhaft angedeutet schon in einer Tagebuchaufzeichnung des jungen Max Horkheimer aus dem Jahre 1918: „Sehnsucht, mein Wesen“. Diese Sehnsucht ist die nach „Humanität“ – in der bürgerlich-aufklärerischen Begriffswelt einer der dominanten Begriffe – und diese Sehnsucht ist nicht nur für die Kritische Theorie der Frankfurter Schule bezeichnend, sondern auch für Existenzliteratur und –philosophie von Heidegger, Jaspers und Sartre, für die philosophische Hermeneutik, vor allem in der Gestalt von Hans-Georg Gadamer und für viele andere Versuche der Rehabilitation der praktischen Vernunft der Aufklärung. Die großen, aber bis heute noch nicht eingelösten, Versprechen und Hoffnungen der bürgerlichen Emanzipation und deren Scheitern heben keineswegs die Frage nach den erforderlichen Voraussetzungen für deren Einlösung auf.
Das „Fast“-Denken, das „Fast“-Verstehen, das „Fast“-Fühlen verursachen die schrecklichsten Gefahren der Zivilisation, denn die „Fast“-Erscheinungen entstehen an der Grenze zur notwendigen Ganzheit unseres Daseins. Gar nicht zufällig hat Goethe sein ganzes Leben lang nach der Ganzheit gesucht. Von mir aus hat man heute schon zu wenig Zeit für das „Fast“-Sein. Die „Spielräume“ der zu Kant alternativen Freiheiten sind ausgeschöpft, denn letztendlich lässt sich die Geschichte der Menschheit, die manchmal in der Tat nach dem Wort von M. Foucault als die „Geschichte des Wahnsinns“ vorkommt, in dem Spannungsfeld zwischen zwei entgegengesetzten „Spielen“ identifizieren – des Lebens mit dem Geheimnis der Freiheit und des Todes, der bestrebt ist, den Menschen zu seinem „Spielzeug“ zu machen, sei es durch das „Lustprinzip“ (Freud) oder durch den „Willen zur Macht“ (Nietzsche) oder durch den schon längst entblößten bloßen Ökonomienutzen…
3. Kant und eine „Insel der Hoffnung“
Gerade vor diesem Hintergrund wirkt das Schicksal Königsbergs besonders prophetisch, gleichfalls aber initiierend für die Suche nach der „Grammatik des Lebens“: Die moderne Zivilisation bedarf einer grundlegenden Rehabilitation der „praktischen Vernunft“ Kants, was letzten Endes die grundlegende Frage betrifft: Die Frage nach dem wahren Sinn der Freiheit. Eigentlich ist diese Frage nach der Möglichkeit der Freiheit entscheidend in der Kantischen Philosophie. Die subjektzentrisch gewordene Ontologie, die sich in der neuzeitlichen Kultur entwickelt hat, hat nach Kant nur eine Überlebenschance, die gerade auf diese Frage angewiesen ist. Ob die Freiheit möglich ist? Ob der Mensch, so Kant in der Schrift „Zum ewigen Frieden“ , als mit Vernunft behaftetes Wesen die freie Kausalität des moralischen Gesetzes realisieren wird? Wenn ja, dann führt der Weg, so Kant, zu einem allgemein das Recht verwaltenden Völkerbund und zum ewigen Frieden und wenn nicht, dann zum ewigen Frieden auf dem Kirchhof der Menschengattung.
In ihrer Typologie ist diese kantische Wahrheit besonders wichtig für Königsberg/Kaliningrad, für den Schauplatz der Geschichte, wo die Suche nach der wahren Identität gleichfalls die nach einer wahrheitsgetreuen und gerechten „Grammatik der Versöhnung“ ist. So im Leben und Werk des bekannten Kaliningrader Schriftstellers Juri Ivanov: Dieser 1928 in Leningrad geborene Schriftsteller ist im Frühjahr1945 in das eroberte Königsberg als Trompeter eines Bestattungskommandos der Roten Armee einmarschiert voller Hass und Zerstörungsgier dem Fremden, dem Feindlichen, dem Deutschen gegenüber. Fast drei Jahre lang hat er in der von der deutschen Wehrmacht eingekesselten Millionenstadt Leningrad verbracht und die ganze Innentragik der aussterbenden Stadt miterlebt, den Kannibalismus eingeschlossen. Und dann, in die Truppe seines Vaters, des Obersten der Roten Armee, aufgenommen, war er an der Front, wo er unzählige Tausende im Feld Gefallene, in Panzern Verkohlte, von Bomben Zerfetzte in unzähligen Massengräbern dienstpflichtig beerdigte. Das Schicksal hat ihn aber nach Königsberg/Kaliningrad gebracht, wo er sich zu einem bedeutenden Schriftsteller entwickelte (über 30 Bücher) und wo er auf dem Posten des Vorsitzenden des Kaliningrader Kulturfonds zu einem der mutigsten Kämpfer für die Idee der Versöhnung wurde.
Wer hat wen gefunden? – Das damals vertriebene Königsberg diesen Schriftsteller Jurij Ivanov oder er dieses in seinen Augen ganz geheimnisvolle faszinierende Königsberg? – ist letzten Endes gar nicht so entscheidend. Entscheidend ist aber dieser Weg zu einander, der im Werk von Jurij Iwanow eine beinahe mythische Prägung gefunden hat.
Er hat Königsberg letzten Endes zum Mittelpunkt des Weltmythos gewählt, was sich in seinem letzten Roman erblicken lässt. Dieser Roman unter dem Titel “Tänze im Krematorium” handelt von den ersten Nachkriegsmonaten in Königsberg, die Jurij Ivanov miterlebt hat. Die Eindrücke von der für ihn damals fremden, in Schutt und Asche gelegten, Stadt, von deren verbliebenen Einwohnern, die als Schatten in den Ruinen herumhausten, plus die erschütternde Erkenntnis der bloßen Grenze zwischen Tätern und Opfern und die Einsicht in die gemeinsame Schuld und in die Notwendigkeit der Sühne – all’ das verleiht diesem letzten Roman die epische Spannung und macht Königsberg mit seinen Totentänzen im Krematorium – so eine Metapher des Infernos – zu einem Weltmodell mit der beinahe verzweifelten Frage “quo vadis?”. Mensch, wohin des Weges?
Die Liebesthematik ist im Mittelpunkt des Romans. Die Liebe zwischen einem sowjetischen Panzeroffizier Nikolaj Below, der sieben deutsche Tiger-Panzer in seinem letzten Kampf um Königsberg bekämpft hat, und der jungen Königsbergerin Viktoria. Die Liebe zwischen den beiden ist aber gar nicht rettend. Der Roman ist tragisch: Viktoria wird im Zuge der Massendeportation der deutschen Zivilbevölkerung ausgewiesen. Nikolaj, für seine Liebe zu einer feindlichen Person streng bestraft, wurde aller Auszeichnungen entbehrt, von der Armee rausgeschmissen. Nikolaj hat aber vor allem den Abschied von Viktoria nicht ertragen können. Er hat sich mit seiner Pistole eine Kugel durch den Kopf geschossen: “… hier, zwischen den Augenbrauen …” – so das letzte Wort des Romans.
Die Liebe zu einer feindlichen Person …Der moderne Fotograf aus Kaliningrad Dmitrij Wyschemirskij ist auch von der Liebe infiziert, involviert, inspiriert: “Ich frage mich selbst”, – so Dmitrij Wyschemirskij in seinem Essay – “was liebe ich so an Dir?
Dachziegel. Kopfsteinpflaster.
Schattenreiche Gärten und Parks von Amalienau und Maraunenhof.
Alte Kastanienbäume und ewig jungen Flieder.
Den einsamen Dom auf der grünen Insel.
Die Farbenpracht von Ahornbäumen im nebligen Oktobermorgen.
Pausenloser Regen im November und bis zur Ohnmacht glücklich blühende Apfelbäume im Mai.
Die Türme von Bastionen und Kirchen…
Alles, was noch nach den Bombardierungen und Kämpfen bei Kriegsende erhalten blieb.
Alles, was nicht verschwand, trotz der Vernachlässigung und der Armut.
Alles, was zusammen mit Spielzeug und Märchengeschichten meine Kindheit gefüllt hat.
Bedeutet es, dass ich in Kaliningrad Dich liebe, Königsberg?
Bedeutet es, dass ich Dich so viele Jahre suche?
In veralteten Geschichten der ersten Übersiedler und in einem besorgten Blick eines alten Deutschen, der als Tourist in seine Jugend zurückkehrt, um für immer sie in der Hast des Tages zwischen vielstöckigen Wohnhäusern zu verlieren.
Ich suche dich in Straßen, die noch die alten Namen tragen: Schillerstraße, Kastanienallee …
In den geheimnisvollen Namen der mittelalterlichen Städte, Altstadt, Kneiphof, Löbenicht. Sie verwandelten sich in braches Gelände an Stelle der alten Stadt und warten geduldig, bis irgendein Architekt, da im Himmel, sich entschließt, Deinen Wiederaufbau zu beginnen.
Ach Königsberg! Soll ich Dich um Verzeihung bitten?”
Was wir hier sehen und hören, hat direkt mit der Kantischen Hoffnung zu tun, eigentlich in einer der Wundestellen Europas, die bis heute nicht geheilt ist. Diese Wunden, die auch im reinen russischen Herzen bluten, erkennt etwas im russischen Geist, was schon mehrmals in den verschiedenen Erscheinungsformen des russischen Genies demonstriert wurde. Dieses Etwas, in dem sich das Wesen der wahren russischen Seele zeigt, sei es Karamsin, Puschkin, Solzhenitzin, Sacharov, ist auf konzentrierte Weise in F.M.Dostojevskij’s weltbekannten Puschkin-Rede in Moskau 1880 zum Ausdruck gebracht: „So auch hat das russische Volk die Reformen Peter des Großen nicht nur aus dem rein utilitaristischen Grunde aufgenommen, sondern auch beinahe zugleich im Vorgefühl eines weiteren, unvergleichbar höheren Ziels. Auf einmal wandten wir uns der eigentlichen lebenswichtigen Vereinigung im innigsten Streben nach der Einheit aller Menschen zu. Nicht feindlich, sondern freundschaftlich nahmen wir in unsere Seele Genies anderer Nationen auf…“ Eine der bedeutendsten von Dostojevskij angedeuteten Ideen der russischen Kultur – brüderliche Einheit mit Menschen anderer Kulturen und Nationen – erscheint übereinstimmend mit den Grundideen des Königsberger Philosophen I.Kant, formuliert z.B. in seinem Traktat „Zum ewigen Frieden“. Kants Traum von dem Weltbürgerrecht und dem Völkerbund entspricht dem Gedanken Dostojevskijs über die Notwendigkeit, „so eine bürgerliche Formel des gemeinsamen Lebens zu finden, die in vollem Ruhm diese sittliche Kostbarkeit für die die ganze Menschheit sichtbar machen könnte.“
Die „sittliche Kostbarkeit“ könnte Königsberg/Kaliningrad, einen der Orte der Vertreibung, zu einem Ort der allumfassenden Versöhnung machen mit einer faszinierenden Perspektive der politischen und ökonomischen Konföderation zwischen Russland und Europa. Ein zentripetales Wegekreuz in Osteuropa, ein Schauplatz der Praxis des neuen Modells der Gerechtigkeit! Königsberg/Kaliningrad könnte zu einem unikalen Modell des Zusammenseins und der Zusammenarbeit verschiedener Nationen und Kulturen werden. So ein Leitfaden auf dem Weg zu einer besonderen Form der slawisch-baltisch-europäischen Konföderation, nach dem Wort Johannes Bobrowski’s (in Tilsit gebürtig) zu einem friedlichen „Sarmatischen Topos“ mit dem Mittelpunkt in der Stadt, wo vor 215 Jahren der Traktat „Zum ewigen Frieden“ Kants verfasst wurde.
Trotz des verwickelten politischen Puzzle-Spiels im „Baltischen Gürtel“ der Weltpolitik lässt sich die Tatsache erkennen, dass Königsberg/Kaliningrad eine ganz besondere Stellung in den Zukunftsszenarien Europas einnimmt, vor allem in den „Szenarien der Hoffnung“. Die Grundidee der Hoffnungspraxis muss aber die allumfassende „Transgression“ (im Sinne von M. Foucault) sein, d.h. der Übergang zu einer neuen Qualität der politischen Denkkultur, der internationalen Kommunikation, des interkulturellen Dialogs, des Wirtschaftens usw. Die Realpolitik für die „Transgression“ kann aber nur in Folge einer neuen Aufklärung vorbereitet werden, denn ohne den paradigmatischen Wechsel geht nicht nur die „Sternmission“ des kulturpolitischen Topos Königsberg/Kaliningrad unter, sondern auch die gesamte moderne Zivilisation.
Königsberg war schon einmal eine „philosophische Hauptstadt der Aufklärung“, im XVIII. Jahrhundert dank der kritischen Philosophie der „reinen“ und „praktischen Vernunft“ von Immanuel Kant. In einer Anmerkung zur „Anthropologie in pragmatischer Hinsicht“ schrieb 7 Kant, Königsberg sei „ein schicklicher Platz für die Erweiterung der Welt- und Menschenkenntnis“. Durch die Wechselfälle des Schicksals, oder der Vorsehung, ist das heutige Königsberg berufen, letztendlich die Mission wahrzunehmen…
1 Lessing G. E., ‚Hamburgische Dramaturgie’, in: Lessings Werke in 5 Bänden, Weimar 1963. Bd. IV, S. 342.
© Prof. Dr. Wladimir Gilmanov