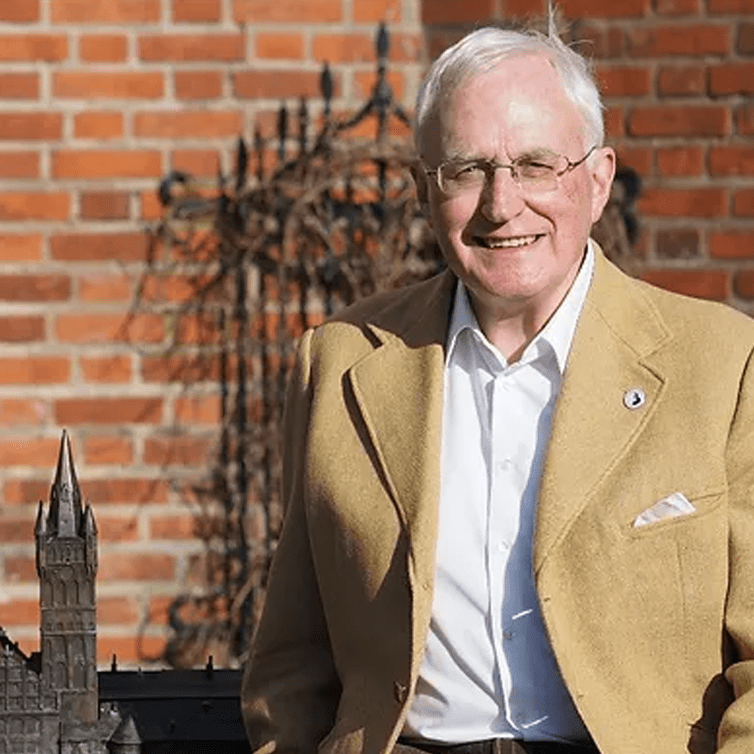„Zum ewigen Frieden“ – das ist, wie wir uns erinnern, der Titel des vor 220 Jahren veröffentlichten Kantschen Traktats, den der große Königsberger dem Aushängeschild eines Gastwirts entlehnt hat. Neben der Aufschrift war auf dem Schild ein Friedhof abgebildet, und Kant stellt Betrachtungen darüber an, wie die Menschheit diesem traurigen Schicksal entgehen könnte. Das heutige Kaliningrad erscheint wie eine Illustration zu den Betrachtungen Kants. Die Stadt ist sowohl eine Warnung vor dem, wozu sich Feindschaft unausweichlich wandelt, als auch eine Hoffnung auf eine große friedliche Zukunft, deretwegen sie einen leeren Raum in ihrem Herzen bewahrt, rund um den Dom, in dem wir uns jetzt befinden. Und sie ist auch ein Zeichen dafür, dass diese Zukunft nicht von selbst kommt, dass es langer und beharrlicher Anstrengung bedarf, damit sie näherrückt. Diese Anstrengung müssen wir, die gegenwärtigen Bewohner der Stadt, in Zusammenarbeit mit allen Menschen guten Willens vollbringen, deren Geschichte ebenfalls mit diesem Landstrich verbunden ist.
Ich will auch etwas von meiner eigenen Geschichte erzählen. Einer meiner Großväter stammte aus dem Kursker Gebiet und beendete diesen schrecklichen Krieg hundert Kilometer von hier zwischen Danzig und Elbing; mein anderer Großvater stammte aus der Ukraine und wurde gleich nach dem Krieg hierher versetzt zum Dienst bei der Baltischen Flotte. Hier haben sie geheiratet: meine eine Großmutter kam aus Perm, einer Stadt im Ural, meine andere aus dem Gebiet Pskov. Hier sind meine Eltern geboren. So kommt es, dass ich Kaliningrader in der dritten Generation bin und meine Kinder in der vierten, das heißt soweit das überhaupt möglich ist. Ich lebe in einer russischen Stadt, deren jetziger Name als Nachhall des Stalinismus erscheint, die aber der ganzen Welt bekannt ist als Heimat des deutschen Philosophen Immanuel Kant, der über die Frage «Was ist der Mensch» überhaupt, unabhängig von seiner Nationalität, nachgedacht hat. Wenn ich aus der Stadt hinausfahre, sehe ich die Lebensspuren vieler Menschen, ihrer erfüllten und unerfüllten Hoffnungen, die Überreste prußischer Siedlungen, auf denen die Ruinen von Ordensburgen stehen, umgeben von funktionslos gewordenen sowjetischen Kolchosen… Aber ich sehe auch, dass daneben Häuser gebaut werden, dass das Leben trotz alledem fortfährt, neuen Wein in alte Schläuche zu gießen.
Das ist ein sehr schwieriges Erbe, aber wie jedes Erbe kann man es nur als Ganzes annehmen, mit allen Konflikten und aufgehäuften Schulden. Der achtsame Umgang damit ist eine Frage der menschlichen Würde, eben derjenigen, die in mir und in jedem anderen Menschen ihr Ziel hat. Ich bin verpflichtet, das mir Zugefallene zu mehren und dafür das kritisch zu vereinigen, was zu vereinigen mühsam ist. Und ich verstehe nicht, wenn jemand mir sagt, hier sei irgendetwas Fremdes, und das damit begründet, dass es «preußisch», «deutsch» oder «sowjetisch» sei. Für mich, einen heutigen Kaliningrader, ist das alles eine Gegebenheit, alles erscheint – kantisch gesprochen – als eine a priori synthetische Einheit. Mehr noch, gerade in der kritischen Vereinigung dessen, was unvereinbar zu sein scheint, in der Überwindung kultureller und zivilisatorischer Widersprüche, in der Suche nach dem Allgemeinen, dem Universalen, sehe ich die Zukunft dieses Landstrichs, der ein Teil Russlands in Europa geworden ist. Wir haben großes Glück gehabt, dass vor 291 Jahren gerade hier Immanuel Kant geboren wurde, den wir alle als großen Meister der Synthese der besten Errungenschaften unterschiedlicher philosophischer Traditionen ehren – und als den wichtigsten Einwohner Königsbergs/Kaliningrads.
© April 2016 Vadim Tschalyj