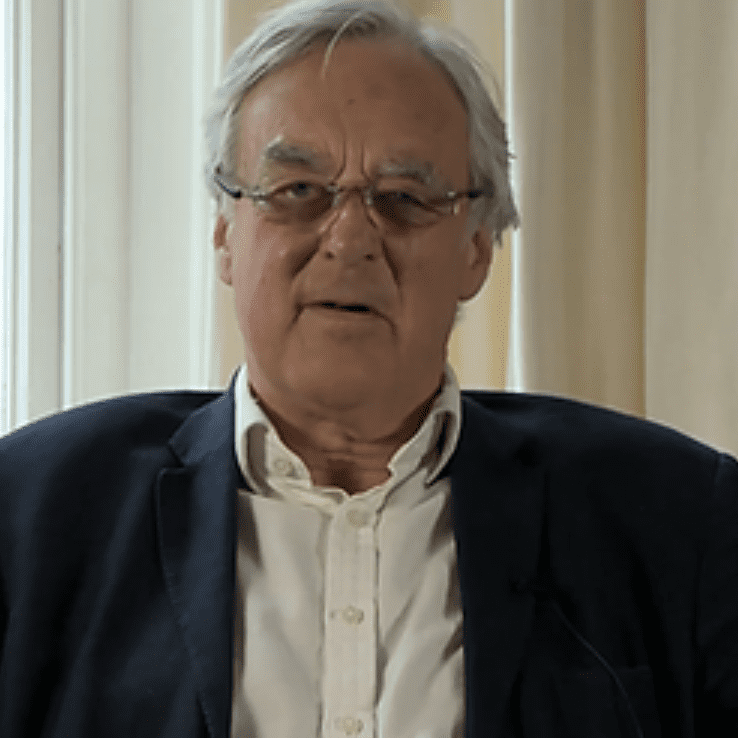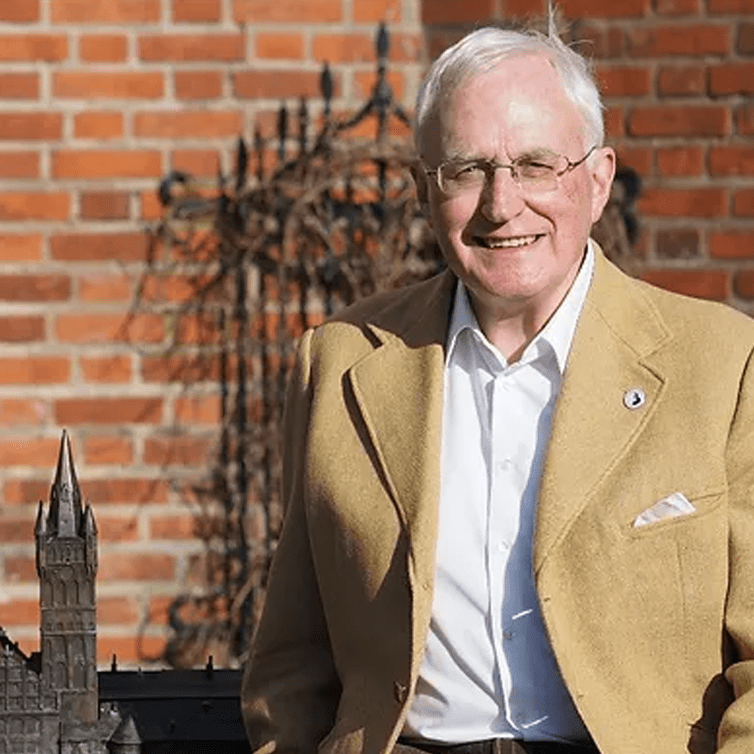Foto des Autors: © Dr. Maja Schepelmann
Eine Tagung in Berlin vom 27.5. bis 29.5.2019
Unter diesem Motto, das ein Jubiläum zum Anlass nimmt, die Aktualität des Gefeierten zu eruieren, fand in Berlin eine von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (BBAW, Berlin) und dem Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa (BKGE, Oldenburg) in Zusammenarbeit mit weiteren Partnern veranstaltete Konferenz statt, die von renommierten Kantforschern und Kantforscherinnen getragen wurde. Mit Blick auf den 2024 zu begehenden 300. Geburtstag Immanuel Kants wurde die universale Bedeutung des großen Philosophen, der an der Albertus-Universität zu Königsberg lehrte, in den Blick genommen. Grußworte wurden gesprochen von Martin Grötschel, dem Präsidenten der BBAW, von Maria Bering, in Vertretung der Kulturstaatsministerin Monika Grütters, und von Matthias Weber, dem Direktor des BKGE. In seinem anschließenden einführenden Vortrag vergegenwärtigte Volker Gerhardt, Projektleiter der Akademie-Ausgabe der Werke Kants, was Kant als europäischen Denker auszeichnet. In seiner 1795 erschienenen Schrift Zum ewigen Frieden fordere er, Europa solle sich um einen Übergang zu einer Gemeinschaft eigenständiger Staaten bemühen und im Ganzen einen „Frieden ohne Vorbehalt“ suchen. Kant sei keineswegs nur ein „transzendentaler Philosoph“, sondern vertrete einen demokratischen Realismus des Vorrangs des Rechts vor der Macht und habe einen praktikablen Vorschlag vorgelegt, wie Europa in seiner Vielfalt als eine Föderation erhalten bleiben kann – eine Idee, die sowohl 1919 bei der Gründung des Völkerbunds wie auch 1945 bei der Konstituierung der Vereinten Nationen leitend war. Auch bei der Bildung der Europäischen Union hat sie Pate gestanden. Gerhardt betonte die Rolle Europas in Kants Herleitung der kritischen Vernunft und machte zugleich deutlich, dass diese die Pflicht habe, sich auch mit der politischen Hegemonie der europäischen Mächte auseinanderzusetzen. Kant sei ein unerbittlicher Kritiker des europäischen Kolonialismus und entwerfe das Gegenmodell einer Weltbürgergesellschaft, in der Eroberungen ebenso wie wirtschaftliche Abhängigkeiten rechtlich-politisch ausgeschlossen werden müssen. Schließlich verwies der Referent auf die globale menschheitliche Perspektive, die Kant in seinen ausgedehnten anthropologischen und geographischen Vorlesungen entwickelt. Ihre kongeniale Entfaltung finde sie in den sprachwissenschaftlichen und geophysikalischen Forschungen von Wilhelm und Alexander von Humboldt, die beide bereits als Schüler eine gründliche Einführung in das Studium der Kritischen Philosophie Kants genossen hatten.
Die Eröffnungsveranstaltung wurde durch eine szenische literarisch-musikalische Lesung Zeitgenössische Stimmen aus Immanuel Kants Königsberg mit Klaviermusik von den Königsberger Komponisten Christian Podbielski (1741–1792) und Johann Friedrich Reichardt (1752–1814) abgerundet. Sie wurde organisiert vom Deutschen Kulturforum östliches Europa (Potsdam).
Die wissenschaftliche Tagung begann mit dem Vortrag Kant und die Aufklärung, in dem Reinhard Brandt erläuterte, unter welchen Anspruch Kant in seiner Schrift Was ist Aufklärung? ausnahmslos alle Menschen stellt: Sie sollten das werden, was sie als eigenständig denkende Wesen, die den Mut finden, sich ihres Verstandes unabhängig von fremder Anleitung zu bedienen, eigentlich immer schon sind. Dies sei möglich innerhalb einer Gesellschaft, die nicht an den Staat gebunden ist, sondern sich einer freien Vernunft öffnen kann, und die sich nicht von den instrumentellen Erwartungen der Obrigkeit abhängig macht. Brandt wies darauf hin, dass die Bewegung der Aufklärung seinerzeit mit größten Einschränkungen und Repressalien durch die Zensur zu kämpfen hatte – mit Ausnahme der wenigen glücklichen Jahre, die Preußen unter Friedrich dem Großen erlebte – dass sie sich allerdings gleichwohl in einer erstaunlichen Manifestation intensivster Selbstreflexion, mit Hilfe der kritischen Philosophie, immer auch darüber aufklären konnte, was Aufklärung nicht ist. Weder zuvor noch hernach habe es überdies ein derartiges Zeitalterbewusstsein gegeben, mit dem die eigene Mündigkeit, verstanden als die in der eigenen Vernunft bereits angelegte Potentialität eines jeden Menschen, geweckt und gegenüber der Fremdbestimmtheit in der Vergangenheit die eigene Selbstbestimmung für der Zukunft angestrebt werden sollte.
Marcus Willaschek führte auf eindrucksvolle Weise philosophische Leistungen vor, die Kants Bedeutung für die Gegenwart unter Beweis stellen. Diese Leistungen sind Teil des allgemeinen Zuges der Kantischen Philosophie, Widersprüchliches zu integrieren und Komplexität herzustellen. Kant erweise sich als ein synthetischer Denker, indem er ein Zusammendenken des scheinbar Unvereinbaren bewältigt. Willaschek zeigte dies und damit Kants Aktualität im Fokus aktueller Probleme exemplarisch am Zusammendenken von Vernunftkritik und Vernunftvertrauen, sodann am Zusammendenken eines moralischen Idealismus und politischen Realismus sowie am Zusammendenken des Glücksstrebens und der Moral in der Ethik. Dass sich überhaupt die Integrationen solcher Kontraste erfolgreich angehen lassen, verdanke sich der Kompetenz der Reichweitenbestimmung jedes Geltungsanspruchs durch kritisches Denken. Statt Gegensätzliches zu eliminieren, sollte man, gerade auch heute, besser Spannungsverhältnisse aufrecht erhalten. Dies reduziert Simplifizierung. Die Fähigkeit zu kluger Grenzbestimmung des Wissens aber schlägt dessen inhaltliche Fehlbarkeit – bei jedem von uns. Gerade heute benötigten wir den Mut, Spannungsverhältnisse auszuhalten, wie Willaschek mit Blick auf politische und gesellschaftliche Brennpunkte zeigte. Der synthetische Denker Kant ermöglicht uns auch, über Klischees seiner Interpretation hinaus zu gelangen, sowie alle in seinen eigenen Schriften nicht kritisch erwogenen Positionen der Prüfung zu unterwerfen.
In ihrem Vortrag über Kants Kritik der Vernunft als Theorie der Freiheit legte Birgit Recki eine Reihe von ursprünglichen Begriffsbedeutungen frei, etwa den des Kritikbegriffs als auf die Beurteilung von Geltungsansprüchen bezogenen Terminus, der erläutern hilft: was kann Vernunft leisten und was übersteigt ihre Möglichkeiten. Die klärende Instanz ist hier wiederum: die Vernunft. Entlang der drei zentralen Themen der Philosophie nach Kant: Was kann ich wissen, was soll ich tun, was darf ich hoffen? sowie der sich daran anknüpfenden Grundfrage: Was ist der Mensch? präsentierte Recki ausgehend von der Grundfigur rationaler Selbstbestimmtheit die Wege, wie die Kritik der Vernunft im Sinne der Analyse der Erkenntnisbedingungen unter anderem auch die Freiheit des Perspektivwechsels ermöglicht. Sie fordere zugleich die Konzentration auf das Unbedingte und lege damit auch den Grund für die Autonomie des eigenen Willens. Der sei Ausdruck der Freiheit des moralischen Handelns, lege den Grund für die Spontaneität des Handelnden und seines Wollens, und schaffe überdies nicht nur die Bedingungen der Möglichkeit ästhetischer Erfahrung, sondern eröffne zugleich die Freiheit, sich des Prinzips der Zweckmäßigkeit im Verständnis aller Spielarten des Lebendigen zu bedienen. Die Zweckmäßigkeit zeige sich nicht allein in den elementaren Vorgängen des Organismus; sie reiche vielmehr bis in die höchsten Leistungen aller Erkenntnisvermögen. Damit gebe es bei Kant keinen Gegensatz zwischen rationaler Vernunft und künstlerischer Erfahrung der Teilnahme am Lebendigen, die auch die Technik einschließt. Kant setze, so Recki, mit seiner kritischen Philosophie neue methodische Standards, wie die Vernunft und die ihr isomorphe Freiheit des transzendentalen, synthetisierenden Subjekts in den einzelnen Funktionen und Modi genau zu bestimmen sind. In diesen Standards zeige sich die kopernikanische Revolution in der Philosophie, der zufolge es geboten ist, nichts mehr aus nur eingeschränkter Perspektive zu denken, wie es etwa in den einseitig rationalistischen sowie in den einseitig empiristischen Ansätzen der philosophischen Tradition der Fall war.
Rainer Forst konzentrierte seinen Vortrag Menschenwürde und Menschenrechte nach Kant auf den politischen, emanzipatorischen Sinn der Rede von „Menschenrechten“. Vor einem Foto, das einen Demonstranten im arabischen Frühling zeigte, in den Händen ein Schild mit der Aussage „Genug der Demütigung“, präsentierte Forst die Fragestellung, ob der/die Einzelne sich als Adressat/in oder als Autor/in von Rechten verstehe, und in welcher Weise er/sie überhaupt die Möglichkeit habe, selbst Autor/in zu sein. Eben die Forderung, eine solche Rolle einnehmen zu dürfen, ziele nicht auf den eigenen Vorteil ab, sondern auf eine neue Ordnung, in der man genau die Art von auktorialer Funktion zugesprochen bekomme, die man eigentlich immer schon hat. Diese band Forst an den Kantischen Würdebegriff und erläuterte, dass in der Regel zu stark die Schutzfunktion von Menschenrechten betont werde. Im Sinne seiner „reflexiven Pointe“ der Menschenrechte sei, wie Forst im Einzelnen ausbuchstabierte, der Gesetzgeberaspekt von größerer Bedeutung.
Pauline Kleingeld erläuterte in ihrem Vortrag über Kants Theorie des Friedens, dass ein Frieden nicht ein Frieden des Friedhofs sein könne, wie auch Kant zu Beginn seiner Schrift Zum ewigen Frieden ironisch zu bedenken gibt. Vielmehr gehe es darum, Frieden durch Recht herzustellen und zu bewahren, und das Fundament der Rechtfertigung dessen sei das angeborene Recht auf Freiheit. Freiheit und Selbstständigkeit bildeten den Kern der politischen Theorie nach Kant, so dass für Republiken von kollektiver Selbstständigkeit gesprochen werden kann, und auch im Völker- resp. Weltbürgerrecht ein Recht, auf andere zuzugehen und Interaktionen vorzuschlagen, allseits zugestanden sein müsse, nicht jedoch bereits ein Recht zur Interaktion selbst. Die Idee einer kollektiven Selbstgesetzgebung in der Republik verbiete alle Formen der Zwangsgewalt, so dass auch völkerrechtlich die strikte Beschränkung auf freiwillige Aktionen zu fordern sei; erst ein weltweit gültiger Rechtszustand resp. eine weltweite Rechtsordnung garantiere wahren globalen Frieden. Auf ihn hinzuarbeiten sei unser aller Pflicht.
Micha Brumlik legte in seinem Vortrag über Kants Religionsphilosophie Kant nicht nur als einen Religionsdenker aus, sondern zeigte darüberhinaus, inwiefern Kant aus den moralphilosophischen Sollenstheoremen das Sein Gottes ableite. Brumlik bezog eine Reihe prominenter theoretischer und interpretatorischer Arbeiten zu diesem Themenkomplex mit ein und erläuterte, inwiefern sich zentrale Aussagen innerhalb der Kantischen Philosophie dazu eigneten, zu einer religiösen, in diesem Falle christlichen, Auslegung ihrer Anwendbarkeit anzuregen. Kant habe damit letztlich einen moralphilosophischen Gottesbeweis vorgelegt. Brumliks Beitrag, in dem eine Reihe neuerer Interpretationen zur Sprache kam, wurde ungewöhnlich kontrovers diskutiert. Daran zeigte sich, wie umstritten Kants Religionsphilosophie bis heute ist. Dies verdankt sich sicherlich dem starken Kontrast zwischen dem Umstand, dass ein Philosoph alle theoretischen Gottesbeweise widerlegt und folglich auch die Ethik nicht auf einen religiösen Glauben gründet, und der Tatsache, dass er gleichwohl der moralisch-praktischen Idee Gottes einen so großen Raum gibt.
Steffen Dietzsch schilderte die Welt des Königsberger Philosophen und Universitätsprofessors auf der Grundlage vieler einzelner Zitate in seinem Beitrag: Vom Königsberger Katheder zur Republik der Vernunft, den er mit dem zerstörerischen Ereignis des Erdbebens von Lissabon im November des Jahres 1755 einleitete, das auch in Königsberg große Schäden anrichtete und die Menschen dazu brachte, nach dem Zorn Gottes zu fragen, statt, wie Kant bereits in jenen Jahren zu bedenken gab, nach den Ursachen unter unseren Füßen. Die Gewissheit, dass der Mensch immer Mensch bleibe, habe Kants Schriften ebenso begleitet wie seine Tätigkeiten im Rahmen der institutionellen Pflichterfüllung an der Albertina, der er in den Jahren, in denen er einen Lehrstuhl bekleidete (1770-1796), spürbar einen eigenen Stempel aufgedrückt habe. Kants Streben war es stets, Fremdbestimmtheit durch starre Regularien abzulegen und sich zu lebendigen Formen des Lehrens und Lernens vorzuarbeiten, ebenso wie es sein Ziel war, im Denken selbst zu unterrichten statt starre Formen überlieferter Philosophie zu lehren.
Volker Gerhardt präsentierte stellvertretend für die beiden HerausgeberInnen Eckart Förster und Jacqueline Karl in einem kurzen Überblick zum Neuen Opus postumum den Stand der Arbeiten an der Edition dieses Nachlasswerkes. Dabei skizzierte Gerhardt die großen Erwartungen, die sich in der Geschichte der Kant-Interpretation auf den Inhalt und die Bedeutung der späten Nachlassnotizen Kants richten und plädierte dafür, die Ansprüche nicht zu hoch zu schrauben. Er erinnerte an die agonale Problemstruktur, die Kants ganzes Werk von den frühen bis zu den letzten Schriften prägt und die von ihm in immer neuer Weise produktiv gemacht wird. Kant, so Gerhardt, sei zu keinem Zeitpunkt ein Denker einer Schule des „Kantianismus“ gewesen. Darin erweise er sich auch seinen Kritikern überlegen, die ihn vom Standpunkt jeweils ihrer Schule auf Positionen festzulegen suchten, die er selbst kritisch aufgehoben habe.
Violetta Waibel fragte in ihrem Vortrag Kant und das Schöne – in der Kunst, wie man überhaupt das Schöne beurteilen könne, was heutzutage nicht leicht zu erörtern sei, da die Gesellschaft eine Fülle dissonanter Vorstellungen über das entwickelt habe, was man schön nennen kann. Anhand einer Reihe von Zitaten aus der Kritik der Urteilskraft zeigte Waibel unter anderem die Nähe des Kantischen zum Platonischen Schönheitsbegriff auf, wobei die enge Verknüpfung des ästhetischen Urteils an das Naturschöne deutlich wurde sowie ebenfalls die Bedeutung der spielerischen Genese aus dem Zusammenwirken von sinnlichen und begrifflichen Elementen des Denkens und Empfindens. Eine Beurteilung des Schönen erfolge mit dem Anspruch auf subjektive Allgemeingültigkeit, und da hier mit unterbestimmten Begriffen operiert werden müsse, sei man auch für den Part der Beurteilung des Schönen letztlich auf die Überlegungen zur Rolle des Genies verwiesen.
Den Abschluss des zweiten Tages bildete die Präsentation Matthias Webers: Kant in Werken der modernen Kunst, die dem Auditorium eine Fülle moderner Kunstwerke näher brachte. Die Breite der Beschäftigung moderner Künstler mit den Inhalten der Kantischen Philosophie überraschte. In aller Kürze ermöglichte Weber das leichtere Verständnis der Bildwerke und eröffnete einen ersten Zugang zu ihnen durch historische und biographische Hinweise. Eine Hilfe bot auch die Einordnung von Bildfolgen in einen größeren Zusammenhang von Schaffensphasen, etwa bei Anselm Kiefers Auseinandersetzung mit Kants Wort vom „bestirnten Himmel“.
Der dritte Tag der Konferenz begann mit drei Vorträgen über die Kritiken Kants, gehalten von den Herausgebern und der Herausgeberin dieser Werke im Rahmen der Neuedition der Akademie-Ausgabe. Dietmar Heidemann legte in seinem Vortrag über Das Neue in Kants „Critik der reinen Vernunft“ dar, dass dieses wahrhaft Neue bei Kant darin bestehe, dass Kant die Unterscheidung zwischen Anschauung und Begriff auf eine absolut neuartige Weise einführe, die deren gegenseitige Irreduzibilität begründe. Erst mittels dieser Unterscheidung seien zentrale, von Heidemann aufgelistete Theoriestücke in Kants erster Kritik überhaupt erst im Sinne ihrer methodischen Rechtfertigung durchführbar. Anschauungen und Begriffe befänden sich nicht in demselben „Vorstellungsspektrum“; eine Anschauung bestimme Kant als eine einzelne Vorstellung mit direktem Bezug zur Sinnlichkeit, wohingegen ein Begriff indirekt referiere und viele Vorstellungen untergeordnet enthalte. Kant setze sich damit substantiell von der Leibnizschen Theorie gradueller Übergänge ab. Heidemann wies des weiteren einige bewusst gesetzte Provokationen Kants in diesem Werk nach – eine davon sei die seinerzeit als unbotmäßige geltende Verwendung der Bezeichnung „Idealismus“.
Jens Timmermann erörterte Das Neue in Kants „Critik der practischen Vernunft“ und brachte zu diesem Zweck zunächst das Neue in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten zur Sprache, das in der Präsentation der Figur der Autonomie bestehe sowie darin, dass ihr mit dem kategorischen Imperativ ein Formprinzip beigeordnet wird, das zugleich handlungsleitend ist. Dieses Formprinzip hebe sich deutlich von anderen Regeln praktischer Vernunft ab, über die die gesunde Menschenvernunft auch seinerzeit durchaus verfügt habe. Neu sei „die philosophisch präzise Formulierung, nicht das Prinzip selbst, das fest im Alltagsgebrauch der praktischen Vernunft verankert“ sei. Timmermann beleuchtete im Einzelnen die Strategien der Rechtfertigung dieses Formprinzips – durch direkte Deduktion, durch Deduktion des bloßen Prinzips, durch Aufweis der Evidenz des prinzipiellen Bewusstseins selbst – womit das Neue in der Critik der practischen Vernunft thematisiert werden kann, die zur Illustration der Wirklichkeit transzendentaler Freiheit und ihrer Abgrenzung zur Naturkausalität mit einigen anschaulichen Beispielen aufwartet. Selbst für Bösewichte, insofern sie über Vernunft verfügten, wirkten synthetische Sätze a priori in der Gestalt handlungsleitender Formprinzipien fraglos willenserweiternd, was eine gegenüber den erkenntniserweiternden Effekten, wie sie die theoretische Philosophie nachweist, neue Geltungsdimension eröffne.
Andrea Esser erläuterte Das Neue in Kants „Critik der Urtheilskraft“ gegenüber den beiden anderen Kritiken sowie gegenüber früheren Schriften. Analoge Gehalte aus Schriften der Sechziger Jahre würden allein durch die Integration in die nun kritische Untersuchung transformiert. Die dritte Kritik widme sich der Brisanz der aus den anderen Kritiken resultierenden Kluft zwischen Naturgesetzen und Freiheitsgesetz und enthebe sie dieser Brisanz mittels des transzendentalen Prinzips der Zweckmäßigkeit, wobei die auf dieser Grundlage mögliche Beurteilungsfähigkeit („Urtheilskraft“) eine zentrale Rolle gerade auch für die Explikation und Vergewisserung über konkrete ethische Anwendungsbedingungen spielt. Esser wies auf, dass viele kurze Bemerkungen in dieser Schrift vor dem Hintergrund einer jeweils reichen Debattenkultur zu lesen und Kants Sätze somit als Stellungnahmen zu verstehen sind. Auf performative Weise stelle Kant so unter Beweis, wie die Urteilskraft begründete Aussagen ermöglicht. Strittig war die Frage, ob die „Belebung“ des menschlichen Gemüts in der Beurteilung des Schönen in Natur und Kunst wörtlich als Ausdruck der Steigerung der Lebendigkeit des Erlebens oder aber nur als metaphorische Rede zu verstehen sei.
Kants Theorie des Lebens wurde von Angela Breitenbach daraufhin untersucht, ob die enthaltene Teleologie wissenschaftstheoretisch fruchtbar zu machen sei, was sie unter anderem an neueren Entwicklungen innerhalb der Philosophie der Biologie aufwies. Von zentraler Bedeutung sei dabei – heute wieder – der Organismusbegriff, dessen spezifische Differenz zu anderen „Naturprodukten“ (wie es bei Kant heißt) nicht kausal-mechanisch erklärbar, sondern erst explizierbar sei aufgrund der Synthesisleistung innerhalb der Theorie sowie mittels der Kategorie der Zweckmäßigkeit. Die Rechtfertigung erfolge hier durch Analogiebildung. Nun stelle man, so Breitenbach, in wissenschaftstheoretisch-methodologischer Hinsicht auch heutzutage fest: Ohne die heuristische Funktion der Zweckmäßigkeit für die Erkenntnis der Natur sei die Erforschung der Natur im Einzelnen nicht zu bewältigen. Die Referentin empfahl: Statt mit dem Positivismus des 19. Jahrhunderts im Rücken die Reduzierbarkeit der Biologie auf die Physik als Grundwissenschaft anzustreben, könne man von Kant die Vorteile eines nicht reduktionistischen, „pluralistischen Einheitsbegriffs“ lernen.
Tobias Rosefeldt ging der Autonomie als Prinzip und damit Kants Theorie der moralischen Normativität auf den Grund, wobei er konstatierte, Autonomie habe heutzutage eine beunruhigend gute Presse – beunruhigend, weil das Seltsame des Kantischen Autonomiebegriffs gar nicht mehr im Bewusstsein sei. Die philosophische Substitution Gottes, als der überlieferten Begründungsautorität für Pflichten sowie der Sanktionsinstanz für versäumte Befolgung, durch die moralische Selbstgesetzgebung der autonomen Person lasse jedenfalls Fragen offen, unter anderem danach, wie ein selbstgegebenes Gesetz zum Handlungsgrund werden könne, insbesondere in Fällen, in denen das Gesollte nicht das Gewollte sei. Fraglich sei auch, woher die Selbstgesetzgebung, grundgelegt im Formprinzip des kategorischen Imperativs, ihre normative Kraft hernehme, da sie inhaltlich unterbestimmt und mit dem Schatten der Willkür sowie unerklärlicher Verbindlichkeit behaftet sei. Selbst die Verdoppelung des vernünftigen Bewusstseins von sich selbst in den Gedankenfiguren homo noumenon (der der Normen und der reinen praktischen Vernunft fähige Mensch) und homo phaenomenon (der von anderen Handlungsmotiven abgelenkte Sinnenmensch) helfe dem nur bedingt ab. Der Referent formulierte abschließend als eigene Quintessenz: Die Person müsse nicht nur autonom sein, sondern eben auch autonom sein wollen.
Jürgen Stolzenberg führte Einzelheiten des komplizierten Verhältnisses zwischen Kant und den Protagonisten der Zeit des Deutschen Idealismus in seinem Vortrag über Subjektivität als Prinzip. Kant und der Deutsche Idealismus aus und stellte eingangs klar: Kant habe sich mit Schelling, Fichte, Reinhold und anderen „nicht in demselben Theorieraum“ befunden. Mit einem „bestimmten philosophischen Gepäck“ seien diese von ihm „weggegangen, um neue theoretische Räume zu erschließen“. Stolzenberg ging unter Einbezug bestimmter Details aus Briefen mit Kant und über Kant, die oft schonungslose Kritik enthalten, auf genuin philosophische Leistungen etwa Fichtes ein, erläuterte aber auch die auf die vorkantische Zeit zurückgreifenden Bemühungen, an rationalistische Positionen im Kontext Wolffischer Philosophie anzuknüpfen. Philosophische Fäden, so die abschließende metaphorische Erkenntnis des Referenten, hätten die Autoren des Deutschen Idealismus bei Kant in der Tat aufgehoben, aber daraus mittels eines grundsätzlich anderen Strickmusters eine ganz andere Art von Kleidungsstücken gefertigt.
Beatrix Himmelmann zeigte in ihrem Vortrag Nietzsche und Kant in einer Fülle an Gegenüberstellungen die gedankliche Kraft der Auseinandersetzung Nietzsches mit der Philosophie Kants und vor allem auch die kritische Begabung Nietzsches, über Kant hinaus zu gelangen, was besonders mit Blick auf Nietzsches Einspruch gegen Kants praktische Philosophie und gegen den bei Kant verfochtenen Primat der praktischen Philosophie aufgewiesen wurde. Für Nietzsche seien moralische Ansprüche notwendig und irreduzibel individuelle Ansprüche, so dass im Kontrast etwa zur platonischen Definition der Tugend als Gesundheit der Seele überhaupt für Nietzsche nur mehr die konkretisierte Isomorphie zwischen der eigenen „Tugend“ und der „Gesundheit der eigenen Seele“ gelte. Die Bedingungen der Rechtfertigung dieser Unterscheidung zwischen Individuellem und Universellem lägen für Nietzsche in der normativen Singularität von Redlichkeit und Wahrhaftigkeit.
Eine weitere wichtige Phase der Kant-Rezeption beleuchtete Massimo Ferrari in seinem Vortrag Kant zwischen Neukantianismus und Phänomenologie. Im Kontrast zum Streben des 19. Jahrhunderts, unter Berufung auf den Kritiker der Metaphysik, nämlich: Kant, jegliche Metaphysik für immer los zu werden, votierte Heidegger für die Lesart, Kant liefere vielmehr eine neue und bessere Begründung einer neuen und besseren Metaphysik. Dieser Vorschlag war nicht vereinbar mit dem regen Interesse etwa Cohens und Husserls, auf der Grundlage der ersten Kritik und wissenschaftstheoretisch-logischer Arbeiten etwa Bolzanos vornehmlich Logik und Methode weiter zu erforschen. Cohen trat auch an, um aus der Kant-Exegese alle Psychologismen zu eliminieren; Husserl wiederum, wie Ferrari erläuterte, gründet wesentliche Theoreme unter Rückbezug nicht auf kritische, sondern auf vorkritische Begriffe Kants. Auch der Konflikt zwischen Heidegger und Cassirer verortet sich in ihren ganz verschiedenen Ansatzpunkten; das Fragen nach den Fundamenten des Bewusstseins von sich selbst und dessen methodischer Rechtfertigung ist wohl schwerlich mit der ungleich konkreteren kulturwissenschaftlichen Perspektive innerhalb einer philosophischen Anthropologie überein zu bringen. Ferrari machte damit anschaulich, in welch vielfältiger Weise man an Kant anknüpfen kann.
In welcher Form Kant im 19. Jahrhundert in Russland rezipiert wurde, und dass die Vermittlung nicht nur durch Wissenschaft, sondern auch durch die Schöne Literatur erfolgte, schilderte Nina Dmitrieva in ihrem Vortrag Kants Bedeutung für die intellektuelle Kultur Russlands. Zunächst führte sie eindrücklich vor Augen, dass die Verbreitung der Aufklärung ganz schlicht darauf angewiesen ist, dass die Menschen lesen können. Im Gegensatz zu westeuropäischen Zahlen zeigten die Statistiken für das Russland des ausgehenden 18. Jahrhunderts einen, nach den verschiedenen Lebensumständen genauer differenzierten, Prozentsatz von drei bis fünf Prozent der gesamten Bevölkerung, für den galt, dass man lesen und dann in der Regel auch schreiben konnte. Der Verbreitung der Aufklärung – und damit auch der Rezeption der Schriften Kants – stand in Russland überdies hindernd entgegen, dass seine Ideen für gefährlich erklärt wurden; Dmitrieva erläuterte, in welcher Weise Autoren und Professoren mit Schwierigkeiten zu rechnen hatten oder sogar des Landes verwiesen wurden. Wichtige Vermittler des Kantischen Denkens waren, unter anderen, Nikolai Karamsin, der Kant noch selbst kennengelernt hatte, sodann Alexander Herzen und Lew Tolstoi.
Susan Neiman rief in ihrem sehr engagierten Beitrag, der zum Abschluss der Tagung die provokative Frage stellte: Was tun Kantianer in Nicht-Kantischen Zeiten?, dazu auf, eine breite Initiative zu bilden und Kant hinaus in die Welt zu tragen, hinaus aus dem Kloster der philologischen oder exegetischen akademischen Beschäftigung und hin zu den drängenden Fragen unserer Zeit, die einen kritischen Blick und kritische Methoden brauchen und verdient haben.
Veranstalter: Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (Berlin), Bundesinstitut für
Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa (Oldenburg);
Partner: Deutsches Kulturforum östliches Europa (Potsdam), Ostpreußisches Landesmuseum (Lüneburg), Freunde Kants und Königsbergs e.V. (Berlin), Kant-Forschungsstelle an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Kant Gesellschaft e.V. (Mainz), Academia Kantiana (Kaliningrad), Baltische Föderale Immanuel Kant Universität (Kaliningrad).
Die Tagung wurde von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien gefördert.
Tagungsbericht: Dr. Maja Schepelmann (BBAW)