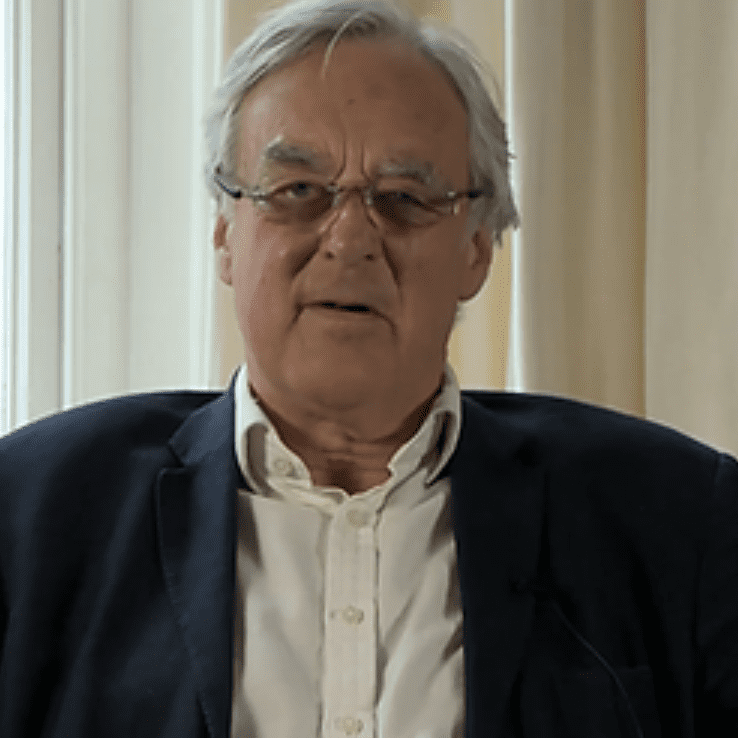Foto des Autors: © I.Rudat
Theodor von Schön als Schüler Immanuel Kants
(Vortragsfassung für Königsberg, 21.04.2012, Deutsch-Russisches Haus, 16:30)
Die Philosophie Kants ist kein Denkgebäude für ein unverbindliches Spiel innerhalb eines intellektuellen Systems. Den Prinzipien seines Denkens wohnt ein Momentum inne, das danach drängt, in den Raum der realen Lebenswirklichkeit übertragen zu werden. Bereits unmittelbar nach dem Erscheinen seiner Werke stellte sich eine Wirkung ein, die auch außerhalb der Philosophie zu leidenschaftlichen Reaktionen bei Gegnern und Befürwortern führte. Bereits zu seinen Lebzeiten fanden seine Vorstellungen in den Köpfen der preußischen Politiker und Beamten ihren tiefgreifenden Niederschlag. Besonders virulent wurde das Denken Kants in der Zeit der preußischen Reformen. Unter den preußischen Reformern war der am 20. Januar 1773 in Schreitlau(g)ken bei Tilsit als fünfter Sohn des Amtsrats und begüterten Domänenpächters Johann Theodor von Schön geborene spätere (seit 1824) Oberpräsident von Ost- und Westpreußen Heinrich Theodor von Schön ein herausragender Kantianer.
Schön wurde bereits in einer von Kant geprägte Atmosphäre hineingeboren. Die Gedanken Kants gehörten gleichsam zum Erbe des Vaters, denn dieser war Hörer bei und Bewunderer von Kant gewesen. Über seinen Vater teilt uns Schön mit: „Mein Vater war ein gebildeter Mann. […] Auf der Universität zu Königsberg war er ein Freund Kants u. hörte bei ihm ein Privatissimum u. blieb mit ihm seines Lebenszeit hindurch in guten Verhältnissen“.1
Im Wintersemester, am 28. Oktober 1788, schreibt sich Schön, noch nicht einmal 16jährig, als Student der Rechte an der Universität Königsberg ein. Um seinen Sohn eine möglichst gute und umfassende Ausbildung zuteil werden zu lassen, sorgt der Vater dafür, daß Kant dessen Studienplan aufstellt und ihn hinsichtlich des Studiums berät. Außerdem legt er ihm nahe, die ersten Semester bei Kant zu hören. Schön berichtet darüber in folgenden Worten:
Im Jahre 1788, Michaelis wurde ich Student. […] Nachdem die Matrikel vom Rector gelöset war, brachte mich mein Lehrer zu Kant. Mein Vater hatte als Student ein Privatissimum bey Kant gehört, u. seit der Zeit waren sie in dem Verhältniß geblieben, daß, wenn mein Vater nach Königsberg kam, sie sich sprachen, u. wenn Gelegenheit zum Gruß war, sie sich grüßen ließen. Mein Lehrer bat, auf Antrag meines Vaters Kant, die Vorlesungen zu bestimmen, welche ich hören sollte. Damals war bei allen Studenten, das erste Studienjahr nur der Allg. Bildung gewidmet, die Brodstudien fingen vollständig erst, nach 1 ½ Jahren an. Kant sagte: Um den Umfang des wissenschaftlichen Gebiets kennen zu lernen, sollte ich Allg. Enzyklopädie bey Prof. Kraus hören.[2]
Christian Jacob Kraus, seit 1781 Professor für praktische Philosophie und Kameralwissenachaften an der Universität Königsberg, war seinerseits Kant-Schüler. Um 1800 zählte er zu den bedeutendsten Vertretern des deutschen, durch die englische Philosophie stark beeinflußten Liberalismus. Durch den Einfluß von Kraus erfuhr Schön seine akademische Initiation nicht nur durch Kant, sondern er bewegte sich auch in einem Kant kongenialen Geistesraum. Sein daraus folgendes Bekenntnis zu einer liberalen Weltsicht sollte ihm während seiner Laufbahn noch viele, nur schwer zu überwindende Hürden bereiten.
Eine weitere zufällige Begegnung in der frühen Königsberger Studentenzeit sollte Schön nicht nur auf die Gedanken Kants einstimmen, sondern die aus der Begegnung erwachsende lebenslange und innige Freundschaft sollte auch dazu führen, daß die Gedanken des Philosophen ständig im Zentrum der Gespräche beider Freunde standen. Während eines lebhaften Gesprächs zwischen „Beamten, Kaufleuten, Studenten und Reisenden“ in einer Königsberger Gastwirtschaft entpuppte sich ein Teilnehmer als profunder Kenner Kants; es war kein anderer als Johann Gottlieb Fichte (1762-1814). Schön berichtet: „Als aber einer aus der Gesellschaft zur Begründung seiner Behauptung sich unrichtig auf Kant bezog, da sagte ihm Fichte: ‚wahrlich habe er Kant nicht gelesen!’ und nun nahm Fichte thätigen Antheil an der Unterhaltung“.[3]
Für Fichte bestand der Beweggrund für den Wechsel von Zürich nach Königsberg darin, den von ihm hochverehrten Kant persönlich kennenzulernen. Er schreibt: „Ich kam nach Königsberg, um den Mann, den ganz Europa verehrt, den aber gewiß in ganz Europa wenig Menschen so lieben wie ich, näher kennen zu lernen“.[4] Er erreichte Königsberg am 1. Juli 1791, suchte Kant drei Tage später in dessen Wohnung auf und überreichte ihm am 18. Juli, gleichsam als Jünger des großen Meisters, seine eigene Schrift Versuch einer Critik aller Offenbarung. Er hatte die Kant dedizierte Schrift nicht ohne Kalkül in kürzester Zeit zusammengeschrieben, um sich so als Geistesgefährte Kants auszuweisen und damit dessen Aufmerksamkeit zu gewinnen. In seinem Tagebuch gesteht er: „Schon lange wollte ich Kant ernsthafter besuchen u. fand kein Mittel. Endlich fiel ich drauf eine Critik aller Offenbarung zu arbeiten, u. sie ihm zu dediciren. Ich fing ohngefähr d. 13. [Juli] damit an u. arbeite seit dem immer ununterbrochen darüber fort“.[5] Bereits zwei Tage später schickt Kant die gelesene Arbeit mit dem Ausdruck seiner Anerkennung an Fichte zurück und bittet diesen, ihn zu besuchen: „… so kam Fichte durch Kant in Königsberg in die gelehrte Welt“ merkt Schön dazu an.[6] Bis zum Tode Fichtes 1814 kreiste der fortwährende Dialog zwischen Fichte, dem die Philosophie Kants eine Öffnung der Welt bedeutete, und Schön beständig um das Denken ihres gemeinsamen Königsberger Leitsterns.
Zu dem engeren Freundeskreis Schöns zählte auch der Nationalökonom Ludwig Heinrich von Jakob (1759-1827), ab 1807 Professor für Staatswissenschaften an den russischen Universitäten in Charkow und St. Petersburg. Auch in diesem Falle war Kant das einigende Band dieser lebenslangen Freundschaft. Dem im Geiste Kants verbundenen Freundeskreis ist außerdem noch der Danziger Pädagoge Reinhold Bernhard Jachmann hinzuzufügen. In einem Brief vom 18. Mai 1820 an seinen Freund Professor Ludwig von Jakob schreibt Schön: „Sie werden den kategorischen Imperativ bei J.[achmann] in Fleisch und Bein gefunden haben, mir ist wenigstens niemals ein Mensch vorgekommen, in den Kant so unbedingt übergegangen ist“.[7] Kant hatte Jachmann nicht ohne Grund als seinen Biographen vorgesehen. Zusammen mit Schön leitete Jachmann in Königsberg die „Friedensgesellschaft“, deren Name den Einfluß der Schrift Kants Vom ewigen Frieden erkennen läßt. Hauptsächliches Ziel dieser Gesellschaft war die Unterstützung und Förderung begabter Schüler und Studenten. Jachmann und Schön waren von der Pädagogik Pestalozzis begeistert und bemühten sich, die Schulordnung im Sinne Kants und unter Berücksichtigung der Pläne Fichtes für eine „Nationalerziehung“ grundlegend zu reformieren.
Weiterhin gehörte auch der Philosophh Karl Rosenkranz (1805-1879), Herausgeber der Werkes Kants und zeitweilig Rektor der Universität Königsberg, zum Freundeskreis Schöns. Schließlich ist auch die Bekanntschaft Schöns mit zahlreichen jungen Offizieren von Bedeutung, denn es waren gerade diese, die vom Geist Kants ergriffen waren und im aufklärerischen Sinne eine Neuordnung vom Militär und Staat anstrebten. Zu ihnen zählten neben Scharnhorst vor allem die späteren Generale Andreas Koehn von Jaski und Karl Friedrich von dem Knesebeck, von dem Schön anmerkt: „… da lebte Kant dermaßen in Knesebe[c]k, daß er mit Eifer die Scharnhorstschen Gedanken aufnahm“.[8] Diese Gruppe von jungen Offizieren liefert gleichzeitig ein sinnfälliges Beispiel für das Auslaufen und Scheitern der preußischen Reformen. Wer militärische Karriere machen wollte, so insbesondere Knesebeck, der sagte sich von Kant los und wurde sogar zum Gegner der aufklärerischen Bestrebungen.
Überhaupt legte Schön auf seinen Reisen und im Rahmen seiner dienstlichen Tätigkeit großen Wert darauf, mit Zeitgenossen zusammenzutreffen, die sich als Anhänger der Philosophie Kants ausgewiesen hatten. Bereits in der Zeit zwischen Universitätsabschluß und Dienstantritt hatte sich Schön den Ruf erworben, ein intimer Kenner der Philosophie Kants zu sein. Auf seiner Studienreise durch Deutschland nach Großbritannien trifft er im November 1796 in Halle ein, wo er ein Kolleg seines Freundes Fichte besucht, ein Unterfangen, das beinahe gescheitert wäre, weil der Hörsaal hoffnungslos überfüllt war. Schön will aber noch andere Vertreter der Geisteswelt treffen: „Goethe und Herder konnte ich nicht sprechen, aber Schiller und Wieland konnten nicht aufhören, mich über Kant zu befragen. Wieland erklärte ihn für den größten Dichter der Zeit, und mit Wärme recitierte er dabei die Stelle: ‚Der gestirnte Himmel über u. das Gewissen in uns!’“.[9]
Die Art von Schöns Reaktion auf seine politischen, wirtschaftlichen und sozialen Beobachtungen läßt erkennen, daß er dabei nicht nur von den theoretischen Grundsätzen der Philosophie Kants ausgeht, sondern gleichzeitig bestrebt ist, diese in der Praxis zur Anwendung zu bringen. Daran, daß Schön gleich nach dem Studium nicht nur Aktenstaub aufwirbeln wollte, sondern im Sinne der Lehr- und Wanderjahre in die Welt hinausdrängte, ist Kant nicht ganz unschuldig. Schön bekennt: „Daß das lederne Gedankenlose Beamtengetreibe, mich schon als jungen Mann so anekelte, daß ich in die Welt mußte, war Follge [sic] der Zeit in der ich lebte, u. der Bildung welche ich durch Kant und Kraus erhalten hatte“.[10] Ähnlich heißt es an anderer Stelle: „In dem gewöhnlichen Beamtengetreibe fand ich keine Ruhe; ich wollte meine Wissenschaft angewendet sehen u. die Länder mehr im Großen betrachten lernen“.[11]
Ein besonders aufschlußreiches Beispiel für die Verbindung von Philosophie und Leben ist die Schilderung seiner Liebe zu Lydia von Auerswald, die er dann 1802 heiratet. Zwar konzidiert er, daß sich hier die Gefühle nicht mit Gewalt, so doch mit aller Macht ihre Bahn brechen, aber man muß sie in eine „intelligente Richtung“ bringen: „… dass wo das Gefühl sich nicht gewaltsam Bahn brach, wie in der Zuneigung zu meiner Braut, ich dieß mehr zu unterdrücken, als zu pflegen geneigt war. Das Kantische ‚Du musst, weil Du sollst’ stand jederzeit in glühenden Buchstaben vor mir, und als ich zum ersten Mal in London Romeo und Julie sah [Covent Garden, 8.10.1798], traten die Worte ‚What shall be, must be’, vor allen hervor’“.[12] Als er schließlich in Arnau auf sein Leben zurückblickt und über „Glück und Unglück im Leben“ sinniert, macht er deutlich, daß er seine Lebenshaltung, für die er Mut als bestimmend ansieht, aus der Philosophie Kants gewonnen hat und daß der Kategorische Imperativ stets sein Lebensprinzip gewesen ist: „Aber (Muth mit Bewußtseyn der Pflicht, Courage, Tapferkeit) du musst, weil du sollst, hat mich niemals verlassen“.[13]
Dieser Grundsatz taucht in den Niederschriften Schöns mehrfach an zentraler Stelle auf. So schreibt er z.B. 1840 rückblickend in „Skizze meines Lebens“: „In den Universitäts-Jahren ging das Seyn i[n] Kant auf. Du musst weil du sollst, wurde mit Flammenschrift in de[n] Charakter aufgenommen“.[14] Von den Anfängen des Studiums bis zu seinem Tode stand dieser Grundsatz daher im Katechismus Schöns als sittliche Verpflichtung ganz oben. In der Auflehnung gegen Napoleon und den damit einhergehenden Reformbestrebungen, die, wie er nicht müde wird zu betonen, weder von Seiten des Monarchen und des Adels, auch nicht vom Volk kommen, sondern ausschließlich von den geistigen Führern eingeleitet werden, sieht er daher auch die politische Gestaltwerdung dieses Grundsatzes. Dabei ist er Realist genug, um zu erkennen, daß die Wende in Preußen auch eine Folge des Napoleonichen Druckes ist: „Der Druck von Aussen nahm zu, die Herabwürdigung d[es] Staates [durch Napoleon] wurde größer. [18]13. Da sprach der Himmel. Da wurde der Satz: Du musst, was du sollst, und du sollst dein Leben an eine Idee, (hier des Staates) setzen, lebendig, und die Idee stand in ihrer Allmacht da“.[15] Die Bewaffnung der ostpreußischen Landwehr, an der Schön maßgeblichen Anteil hat, ist für ihn die Krönung dieses Grundsatzes im politischen Bereich. Umso schmerzlicher ist daher für ihn der Rückfall in „die alte Zeit vor dem Jahr 1806“.[16] Der sonst so nüchterne und ironisierende Schön gibt sich in diesem Punkt ganz dem Pathos hin: „… wer die Morgenröthe [im] vollen Glanze gesehen hatte, der konnte den Gedanken des Rückganges nicht [er]tragen“.[17] Statt der „Gestaltung von Ideen“[18], wie sie die Reformer betrieben mit dem Ziel, ein neues Gemeinwesen zu schaffen, führen die restaurativen Kräfte nach 1813 wieder „die Zwangsjacke der Gedanken“ [19] ein. Als einziger Trost verbleibt Schön, daß die neuen Ideen in der unmittelbaren Umgebung von Kant nichts von ihrer Lebendigkeit verlieren.
In einem Schreiben an den Historiker Johann Droysen (1808-1884) vom 23. November 1846 teilt Schön mit, daß vier Bilder in der Halle des Herrenhauses in Preußisch-Arnau seine grundsätzliche Verehrung zum Ausdruck bringen: „In meinem Saale habe ich die Bilder von vier preußischen Helden aufgestellt, Kopernikus (Sonne, steh’ stille, und sie steht), Kant (du musst, weil du sollst), Herder (des Schicksals Gesetz ist ewige Wahrheit) und Simon Dach (ich bin ja, Herr! In deiner Macht). Und alle vier wurden nicht von der Masse der Volksgedanken unmittelbar getragen, sondern ihr Licht kam von oben, wo die Geburtsstätte der Ideen ist. Sie brachen Bahn und Alles, was in Preußen später geschehen ist, wäre nicht geschehen, wenn die Heroen nicht gewesen wären“.[20] Mit den Begriffen ‚Ideen’ und ‚Masse der Volksgedanken’ werden grundsätzliche Vorstellungen Schöns angesprochen, auf die noch einzugehen sein wird.
Nicht ohne Selbstironie und einem Seitenblick auf seine lebensreformerischen Bemühungen stellt Schön am Ende seines Lebens, drei Jahre vor seinem Tode in einem Brief an den Chronisten, Literaten und Diplomaten Karl August Varnhagen von Ense (1785-1858), fest:
„Ich bin 81 Jahre alt und meine Lebenszeit kann nur noch kurz sein, so sehr ich sie auch durch Kantische Philosophie und körperlich durch Sauerkraut zu verlängern bemüht bin“.[21] Was hier in ironischer abgeklärter Distanz des Alters aufleuchtet, ist die Überzeugung Schöns, daß die Gedanken Kants für ihn so etwas wie ein Lebenselixier darstellten.
* * *
Kants Vorstellung von der Kraft der Vernunft und des Verstandes, die dem einzelnen zur Verpflichtung seiner Handlung wird, findet in dem politischen Raum Schöns eine vielfache Ausgestaltung. Dies erklärt Schöns Vorbehalte gegen „Masse“ und „Herde“, denn diese handeln in der Regel aus „Gewohnheit“, ohne die Vernunft zu gebrauchen. Unter dem Einfluß von Gewohnheiten kann der Mensch allenfalls zu Nachahmungen, jedoch nicht zu Urteilen kommen. Im Gegensatz zur Romantik geht Schön daher grundsätzlich von einem vernunftorientierten Individualismus aus. In diesem Sinne muß er daher nicht nur „Masse“, „Mehrheit“ und „Allgemeinheit“ ablehnen, sondern er muß auch die Fürstenherrschaft des aufgeklärten Absolutismus verneinen, weil diese dem Individuum das Recht auf Eigenständigkeit vorenthält. Bei Kant finden sich immer wieder Hinweise, die als Ausgangspunkt dieser Vorstellungen dienen. In den Vorlesungen Kants über Logik heißt es z.B.:
Die Hauptquellen der Vorurteile sind: Nachahmung, Gewohnheit und Neigung.
Die Nachahmung hat einen allgemeinen Einfluß auf unsere Urteile; denn es ist ein starker Grund, das für wahr zu halten, was andere dafür ausgegeben haben. Daher das Vorurteil: was alle Welt tut ist recht.- Was die Vorurteile betrifft, die aus der Gewohnheit entsprungen sind, so können sie nur durch die Länge der Zeit ausgerottet werden, indem der Verstand, durch Gegengründe nach und nach im Urteilen aufgehalten und verzögert, dadurch allmählich zu einer entgegengesetzten Denkart gebracht wird. Ist aber ein Vorurteil der Gewohnheit zugleich durch Nahahmung entstanden, so ist der Mensch, der es besitzt, davon schwerlich zu heilen. – Ein Vorurteil durch Nachahmung kann man auch den Hang zum passiven Gebrauch der Vernunft nennen […] Vernunft ist zwar ein tätiges Prinzip, das nichts von bloßer Autorität anderer, auch nicht einmal, wenn es ihren reinen Gebrauch gilt, von der Erfahrung entnehmen soll. Aber die Tätigkeit sehr vieler Menschen macht, daß sie lieber in andere Fußstapfen treten, als ihre eigenen Verstandeskräfte anstrengen. Dergleichen Menschen können immer nur Kopien von anderen werden; und wären alle von der Art, so würde die Welt ewig auf einer und derselben Stelle bleiben. Es ist daher höchst nötig und wichtig, die Jugend nicht, wie es gewöhnliche geschieht, zum bloßen Nachahmen anzuhalten.[22]
Mit diesen Gedanken Kants öffnet sich der Kosmos der Vorstellungen Schöns.
Kant verwendet wiederholt das Bild der Herde für die Mitglieder eines politischen Gemeinwesens, die ohne eigene Entscheidungsmöglichkeit ausschließlich dem Diktat eines Souveräns ausgesetzt sind. In Anthropologie in pragmatischer Hinsicht schreibt er z.B.: „Der Mensch war nicht bestimmt wie das Hausvieh zu einer Herde, sondern wie die Biene zu einem Stock zu gehören“.[23] Aus dieser Sicht wertet er sogar eine gegenüber dem Untertan wohlwollende Regierung, die den Bürger in durchaus väterlicher Absicht wie unmündige Kinder behandelt, als absolute Despotie. In „Über den Gemeinspruch“ heißt es bezeichnend:
„Eine Regierung, die auf dem Princip des Wohlwollens gegen das Volk als eines Vaters gegen seine Kinder errichtet wäre, d.i. eine väterliche Regierung (imperium paternale), wo also die Unterthanen als unmündige Kinder, die nicht unterscheiden können, was ihnen wahrhaftig nützlich oder schädlich ist, sich bloß passiv zu verhalten genöthigt sind […] ist der größte denkbare Despotismus“.[24] Dieser Grundgedanke mit der Bildlichkeit Kants taucht wie ein Echo bei Schön an prominenter Stelle wiederholt auf. Besonders deutlich wird die Anlehnung an den Königsberger Philosophen, wenn Schön sich mit dem Verhältnis von Regierung und Kirche auseinandersetzt. Besonders verwerflich ist es nach Schön, wenn die Regierung die Kirche benutzt, „um die Heerde zusammen halten zu können“.[25] Nur ein Staat, der seinem Volk nicht die erforderliche Bildung ermöglicht, trachtet danach, im Verein mit der Kirche zu handeln. Gehen Staat und Kirche Hand in Hand, so ist dies letztlich nur Ausdruck eines Zustandes der Despotie. Schön schreibt: „So lange der Culturstand der Völker es den despotischen Gouvernements erlaubte, die Völker wie eine Familie (willenlose Unmündige, nach Kant Heerde) zu behandeln […] war diesen despotischen Gouvernements der Beistand der Kirche, als Mittel zum unlauteren Zweck, durchaus nöthig …“.[26] Schön verweist ausdrücklich auf Kants Urteil über das imperium paternale und wiederholt in diesem Zusammenhang dessen Auffassung, daß es sich dabei um einen „Widerspruch in sich“ oder eine „Mißgeburt“ handelt. Befreit sich der Staat von einer paternalistischen Regierungsform, so unterwirft er sich auch nicht länger dem Einfluß der Kirche: „Abstrahiert ein Gouvernement von der sogenannten Väterlichen Regierung (nach Kant Widerspruch in sich, Mißgeburt) so ist Differenz mit der Kirche unmöglich“.[27] Die Ansichten Schöns fallen in diesem Zusammenhang etwas leidenschaftlich aus, da die heftigen Auseinandersetzungen mit der katholischen Kirche in seiner Amtszeit als Oberpräsident von Westpreußen deutliche Spuren hinterlassen haben. So bemerkt er erklärend: „Dass in den gesamten Preußischen Staaten kein Staatsbeamter, welcher unmittelbar vor dem Volke steht, so lange und so viel mit der katholischen Geistlichkeit zu thun gehabt hat, als dieß bei mir von 1816-42 der Fall gewesen ist“.[28]
Bedient sich der Staat daher der Kirche zu seiner Machtausübung, so ist er nichts anderes als ein „Hüter u. Treiber einer Heerde“. An diesem Punkt nehmen die Vorstellungen Schöns fast schon revolutionären Charakter an, denn er billigt den Untertanen, die das Wesen dieser unheiligen Allianz erkannt haben, sogar so etwas wie ein Widerstandsrecht zu, ganz offensichtlich nicht ohne Blick auf die Französische Revolution: „Eine Regierung welche aber die Kirche mehr als dieß zu ihrer Erhaltung bedarf, ist nicht Regierung, sondern Hüter u. Treiber einer Heerde zu einem selbstsüchtigen Zweke […] da ist es unvermeidlich, daß das Volk gleich einer Heerde Vieh, so bald es die Unlauterkeit des Verfahrens seiner Hirten bemerkt, dagegen tobt“.[29]
Für Kant ist die in der Vernunft wurzelte und aus der Urteilskraft resultierende Idee der Gegenentwurf zum Vorurteil. Hierin folgt ihm Schön, und es ist auffällig, welche zentrale Rolle Ideen in seinen Plänen und Niederschriften spielen. In einem aufschlußreichen Aufsatz über „Theodor von Schön als Reformer und die Polenfrage“ hebt Hans Rothe diese Neigung mit den Worten hervor: „Schön führte alles, was er dachte und aussprach, bis zum Überdruß auf ‚Ideen’ zurück, deren Mangel bei anderen er, nicht ohne Hochmut, anprangerte“.[30]
Schön selbst schreibt in einem Brief vom 28. Dezember 1853 an Varnhagen von Ense: „Mein Freund Eichendorff, der ebenso herrliche Mensch, als herrlicher Dichter, der mich genau kennt, meint von mir: ich sei dazu geboren, dem gemeinen Gang der Meinungen und der Handlungen in den Weg zu treten. […] da das Wesen meines Lebens in einem Sturm auf Ideenlosigkeit und Gemeinheit bestand“.[31] Allein diese Einschätzung Eichendorffs läßt erkennen, daß Schön ein ebenso kritischer wie auch unbequemer Zeitgenosse war, der seinen Mitmenschen mit entlarvender Ironie und beißendem Spott gegenüber treten konnte. Bisweilen ging er in seinem Urteil auch zu weit, so daß er andere tief verletzte.
Schön war kein Freund des Adels, denn dieser war für ihn die Verkörperung von Vorurteil und Gewohnheit. Im Grunde wertete er den Adel letztlich als Ergebnis eines niedrigen Bildungsstandes von einem Gemeinwesen, in dem die unmündigen Mitglieder der Führung durch den Feudalherren bedürfen. Ein aufgeklärtes Ostpreußen, das er wiederholt als „Vaterland Kants“ bezeichnet, muß für ihn daher in einem grundsätzlichen Widerspruch zur Adelsherrschaft und zum Feudalismus stehen: „Der Adel, der bey einem niedrigen Culturstande des Volkes, sich von selbst bildet (die Heerden fordern Hirten) […] Das Vaterland Kants sah zu klar, um an einer solchen Mißgeburt Theil nehmen zu können“.[32] Den Adel in dieser Weise zu definieren und die bestehende soziale Ordnung als „Mißgeburt“ zu bezeichnen, birgt ein gefährliches revolutionäres Potential. Es ist daher nur folgerichtig, daß Kant, wie Schön vermerkt, von den Vertretern des politischen Systems, auf das heftigste abgelehnt wurde, daß „Kant bei den Oorthodoxen [sic] verketzert war“.[33]
Generell ging es Schön um die Überwindung der geburtsständischen Gliederung im politischen und auch wirtschaftlichen Bereich. Die Herrschaft der „Ultra-Aristokraten“, wie er sie zu nennen pflegte, vor 1807 war für ihn ein „verrottetes Zeitalter“ und eine „finstere Zeit“.[34] Fundament dieser überlebten Ordnung war die Leibeigenschaft. Im Zentrum der Bemühungen Schöns stand daher, um seine Worte zu benutzen, die „Aufhebung der Sklaverei“.[35] Auch hier weist Kant seinem Zögling den Weg zum Ziel. Wie Schön berichtet: „Kant sagte mir etwa im Jahre 1795, die Eingeweide drehten sich ihm im Leibe um, wenn er an die Erbuntertänigkeit bey uns dächte“.[36] Hatte bereits Kant gefordert „In der Tat ist’s eine große Gabe des Himmels, einen geraden […] Menschenverstand zu besitzen. Aber man muß ihn durch Taten beweisen …“ [37], so erblickt Schön hierin einen Handlungsauftrag. Die konsequente Verfolgung dieses Ziels bringt ihn nicht nur in einen Gegensatz zum Beamtenapparat, sondern sie läßt auch erhebliche Spannungen gegenüber dem Kreis der Reformer entstehen. Selbst Hardenberg und Stein bleiben davon nicht verschont. Zwar war Hardenberg, der aus dem Hannoverschen kam und in Ansbach als Beamter groß geworden war, nicht mit den Verhältnissen im Osten vertraut und bedurfte der leitenden Hilfestellung Schöns. An diesem Punkt setzt die Kritik Schöns jedoch nicht an. Vielmehr ist es das Fehlen von Ideen im Sinne Kants, das er persönlich als enttäuschend empfindet: „Die Entdeckung bey Hardenberg, daß er im Staatswesen kein Mann von Idee, sondern ein gewöhnlich gesellschaftlich gebildeter Mensch sey, machte mich unglücklich“.[38]
Als Staatskanzler bestand das Hauptziel Hardenbergs in der Schaffung von Reichsständen, wobei er sich durch alle Widerstände des Adels hindurchlavieren mußte. Nur zu gerne leistete ihm Schön dabei Schützenhilfe, die sich jedoch nur darauf bezog, den Adel an die Leine zu legen. Im Sinne der parlamentarischen Vorstellungen Schöns lag es nicht, Reichsstände zu schaffen. Das Ergebnis war, daß die Anordnungen und Verwaltungserlässe Hardenbergs vielfach die Handschrift Schöns trugen und damit unverkennbar dessen fast revolutionäre Akzente aufwiesen.
Mit der Agrarreform von 1806 war Hardenberg jedoch überfordert, einmal weil ihm seine außenpolitischen Pflichten keine Zeit ließen, zum anderen, weil er noch zu sehr dem Denken des 18. Jahrhunderts verhaftet war. Zusammen mit dem Reichsfreiherrn vom Stein versuchte Schön nun, seine Reformideen mit Hilfe Hardenbergs durchzusetzen. Alle Bemühungen blieben jedoch auf halbem Wege stecken oder wurden in der restaurativen Zeit nach 1817 zurückgedreht. Die Teilnahme der Bauern an den geplanten Kreis- und Provinzialständen konnte nicht erreicht werden. Nach hoffnungsvollen Königsberger Reformansätzen wies die Provinzialordnung von 1824 wieder ein eindeutiges Übergewicht des Adels auf.
Stein galt als Jakobiner und die Verwirklichung seiner Ideen wäre einer unblutigen Revolution gleichgekommen. In Zusammenhang mit der geplanten Verwaltungsreform hatte er unter dem Einfluß Schöns ganz in der Sprache Kants gefordert: „Man muß die Nation daran gewöhnen, ihre Geschäfte selbst zu führen und aus diesem Zustand der Kindheit herauszukommen, in dem eine ewig unruhige, ewig geschäftige Regierung die Menschen halten möchte“.[39] Der gleiche Geist Kants spricht 1808 aus der Anordnung Steins, die Methoden Pestalozzis in den Volksschulen einzuführen, weil sie, in den Worten Steins, „Selbständigkeit des Geistes erhöht, den religiösen Sinn und alle edleren Gefühle des Menschen erregt, das Leben in der Idee befördert und den Hang zum Leben im Genuß mindert und ihm entgegenwirkt“.[40] Auch Schön läßt sich dies angelegen sein und sorgt im Laufe seiner Amtszeit dafür, daß in West- und Ostpreußen mehr als 400 Volksschulen entstehen.
In zahlreichen Anordnungen und Erlässen Steins manifestiert sich das Denken von Schön. In vielem erscheint Schön sogar als Gedankengeber von Stein. Dort jedoch, wo Stein als Politiker Grenzen sah, wollte Schön weitergehen. In diesem Zusammenhang ist das sogenannte „Politische Testament“ Steins von 1808 besonders aussagekräftig. Schön merkt dazu an: „…das Steinsche politische Testament, an welchem aber Stein, so viel Antheil hatte als Ludwig XVI.an der französischen Constitution“.[41] Eine der sarkastischen Bemerkungen Schöns, denn Ludwig XVI. stimmte 1791 nach seiner Rückkehr nach Paris der Umwandlung Frankreichs in einer konstitutionelle Monarchie lediglich gezwungenermaßen zu. Betrachtet man die Entstehungsgeschichte des Steinschen Testaments genauer, so wird offenbar, daß Schön fast ausschließlich die Feder geführt und Stein seinen Namen gegeben hat. Es war dies ein genialer Schachzug Schöns. Er hatte erkannt, daß die restaurativen Kräfte den Reformprozeß unaufhaltsam zurückdrängten. Indem er dieses manifestartige Medium wählte und mit dem Namen Stein ausstattete, der inzwischen zu einem Symbol der Reformen geworden war, konnte er seine Kantischen Ideen auch in die Zukunft wirken lassen. Zwar versuchte die Polizei, die in den Berliner Buchläden ausgelegten Exemplare als „demagogische Erzeugnisse“ zu beschlagnahmen, konnte aber die Wirkung dieses Manifestes letztlich nicht unterbinden. Schön ließ 1840 sogar Faksimiles seines Originalentwurfs herstellen und verteilen. Damit trat er als Urheber auch öffentlich in Erscheinung.
Ein Jahr vor seiner Entlassung 1842 hatte der „Alte in Arnau“, wie er in späteren Jahren allgemein genannt wurde, ein weiteres Manifest verfaßt und diesem den programmatischen Titel Woher? und Wohin? verliehen. Auch dieses Pamphlet sollte der Nachwelt die politische Richtung weisen. Schön war sich der Brisanz dieser Schrift durchaus bewußt und wollte sie daher streng vertraulich behandelt wissen. An enge Freunde und absolut Vertraute verschickte er lediglich 32 Exemplare; gleichwohl ging auch ein Exemplar an Friedrich Wilhelm IV. Kernpunkt war Kants Auffassung von der Autonomie der sittlichen Persönlichkeit, die zur gleichberechtigten Verantwortlichkeit der Staatsbürger führen mußte. Auch das GottesGnadentum des Herrschers war für den Schüler Kants bei aller Königstreue nicht hinnehmbar. Das aber bedeutete konstitutionelle Monarchie, Abbau der Standesschranken sowie parlamentarische Repräsentation. Um die Gefährlichkeit seiner Argumentation etwas abzumildern, drückte sich Schön sehr vosichtig aus. Sie richte sich „nicht gegen den Souverän“, so kann man in der Schrift lesen, „sondern gegen die Werkzeuge des Gouvernements, die das Volk in Unmündigkeit erhalten wollen“.[42] Noch in anderer Hinsicht bot das Pamphlet gefährlichen Sprengstoff, denn es erinnerte implizit an das nicht eingelöste Verfassungsversprechen Friedrich Wilhelms III. von 1815. Der konservative preußische Innenminister Gustav Adolf Rochus von Rochow (1792-1847) setzte unverzüglich seinen Polizeiapparat gegen diese staatsfeindliche Denkschrift in Bewegung. Jedoch erschien 1842 in Straßburg außerhalb des Zensurbereiches des Deutschen Bundes ein Raubdruck in hoher Auflage, dem weitere Auflagen folgten. So bewirkte Schön auch in seiner letzten Lebensphase, daß Kant Einfluß auf die politische Diskussion des Vormärz nahm.
***
Die vorausgegangenen Ausführungen erlauben zwei wesentliche Schlußfolgerungen: Die geistige aber auch persönliche Stellung Schöns zu Kant läßt eine Nähe erkennen, die in ihrer Intensität und Wirkung vom Studium bis zum Tode Schöns anhält. Diese Bindung ist zweitens ein entscheidender Schlüssel für das Verständnis der Persönlichkeit und der Handlungen Schöns. Sie verdeutlichen zugleich den Einfluß und den Anteil aufklärerischen Gedankengutes an den Reformen Preußens.
Schön handelt grundsätzlich im Geiste Kants. Sein Ziel ist es, die Prinzipien Kants in praktische Politik umzusetzen. Zwar betont bereits der große Chronist der preußischen Geschichte, Leopold von Ranke, diese Ausrichtung auf Kant, wenn er anmerkt, daß Schön zu den „bedeutendste[n] Schülern Kants“ zählt und weiter ausführt, daß er „lebte in den Ideen des Staates an sich, in welchem Bezug ihm weder Hardenberg, noch weniger Stein genügten.
[…] In Schön erschien bereits eine liberale Tendenz, welche über die Zugeständnisse, die Hardenberg machen wollte, weit hinausging“.[43]
Die enge Verbindung zwischen Prinzipien und politischen Entscheidungen ist jedoch bislang noch nicht eingehend untersucht worden. Mit seiner Handlungsweise als philosophischer Realist wird Schön zu einer einzigartigen Figur der deutschen Geschichte. Er war weitaus mehr als nur Beamter und Politiker; er wollte eine auf Kant gegründete politische Welt in der Realität schaffen. Eine derartige Haltung ist gerade für einen Politiker nicht leicht. Heftig waren die Anfeindungen gegen ihn. Seine zahlreichen Gegner, ob nun auf klerikaler, feudaler oder kameralistischer Seite, sahen ihn, wie Schön in einer Niederschrift vermerkt, als „Anstifter der neuen Zeit“, als „Jakobiner“ und „Antichristen“.[44] In einzigartiger Weise hat der „Alte von Arnau“ Kant dem realen Geschehen der politischen Welt vermittelt und damit nicht nur seiner Zeit den Stempel des Denkens von Kant aufgeprägt. Der Einfluß seines Wirkens erstreckt sich auf diese Weise bis in unsere Zeit.
© Dr. Walter T. Rix, Kronsbek 10, D-24214 Noer-Lindhöft, Tel.: + (0)4346-7800, Fax: +(0)4346-601483 E-Post: waltertorsten.rix@gmail.com
[1] Theodor von Schön, Persönliche Schriften, Bd. 1: Die autobiographischen Fragmente. Mit einer Einführung herausgegeben von Bernd Sösemann. Bearbeitet von Albrecht Hoppe (Köln, Weimar, Wien, 2006), S. 526. (Veröffentlichungen aus den Archiven Preussischer Kulturbesitz, Bd. 53,1)
[2] Persönliche Schriften, I, S. 63-65.
[3] Persönliche Schriften, I, S. 67.
[4] Fichte-Gesamtausgabe, Rh. II, Bd. 1, S.415.
[5] Fichte-Gesamtausgabe, Rh. II, Bd. 1, „Tagebuchaufzeichnungen“, S. 415.
[6] Persönliche Schriften, I, „Der frühe selbstbiographische Versuch“, S. 533.
[7] Hasenclever, Briefe, S. 358; Persönliche Schriften, I, S. 359.
[8] Persönliche Schriften, I, S. 537.
[9] Persönliche Schriften, I, S. 86.
[10] Persönliche Schriften, I, „Autobiographica“, S. 724
[11] Persönliche Schriften, I, S. 536.
[12] Persönliche Schriften, I, S. 135.
[13] Persönliche Schriften, I, „Glück und Unglück im Leben“, S. 727.
[14] Persönliche Schriften, I, „Skizze meines Lebens“, S. 630.
[15] Persönliche Schriften, I, „Skizze meines Lebens“, S. 631.
[16] Persönliche Schriften, I, „Skizze meines Lebens“, S. 632.
[17] Ebd
[18] Ebd
[19] Ebd
[20] Johann Gustav Droysen, Briefwechsel, 2 Bde. (Stuttgart, 1929), S. 677. (Deutsche Geschichtsquellen des 19. Jahrhunderts, Bd. 26)
[21] Persönliche Schriften, I, S. 4.
[22] Immanuel Kant, Gesammelte Schriften. Hg. von der Preußischen Akademie der Wissenschaften (Berlin, 19021941), Bd. IX: Vorlesungen Kants über Logik, S. 76.
[23] I. Kant, Gesammelte Schriften, Bd. VII: Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, S. 330.
[24] I. Kant, Gesammelte Schriften, Bd. VIII: „Über den Gemeinspruch“, S. 290f.
[25] Persönliche Schriften, I, S. 403.
[26] Ebd.
[27] Persönliche Schriften, I, S. 404.
[28] Persönliche Schriften, I, S. 405.
[29] Persönliche Schriften, I, S. 404f.
[30] Hans Rothe, „Theodor von Schön als Reformer und die Polenfrage“, Forschungen zur Brandenburgischen und preussischen Geschcihte, Neue Folge, 15,1 u. 15,2 (2005), 105-130 u. 225-259, S. 114.
[31] Zitiert nach B. Sösemann, Persönliche Schriften, I, S. 4.
[32] Persönliche Schriften, I, S. 451 ebenso S. 466.
[33] Persönliche Schriften, I, S. 534.
[34] Persönliche Schriften, I, S. 412 u. 478.
[35] Persönliche Schriften, I, S. 724.
[36] Persönliche Schriften, I, S. 566.
[37] I. Kant, Gesammelte Schriften, Bd. IV: Prolegomena, S. 259.
[38] Persönliche Schriften, I, S. 566.
[39] Zitiert nach Hermann Witte, Bauernbefreiung und Stadtordnung und die Ostpreussen (Kitzingen, o.J.), S. 19f. (Schriftenreihe des Göttinger Arbeitskreises, Heft 9)
[40] H. Witte, Bauernbefreiung, S. 21f.
[41] Persönliche Schriften, I, S. 631.
[42] Text von Woher? und Wohin? in: Hans Fenske (Hg.), Vormärz und Revolution 1840-1849 (Darmstadt, 1976), S. 34-40. (Quellen zum politischen Denken der Deutschen im 19. und 20. Jahd., Freiherr vom Stein Gedächtnisausgabe, 4)
[43] Leopold von Ranke, Denkwürdigkeiten des Staatskanzlers Fürsten von Hardenberg (Leinpzig, 1877), Bd. 4, S. 239f.
[44] Persönliche Schriften, I, S. 731f.